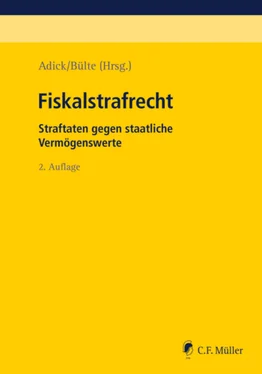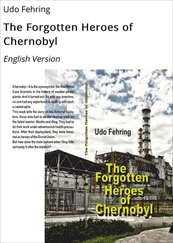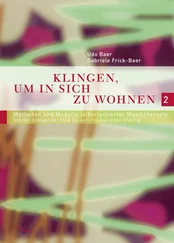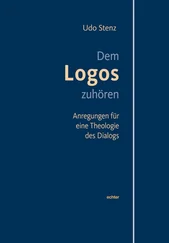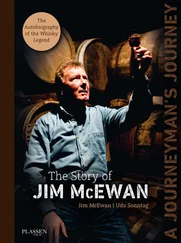[9]
Vgl. hierzu Baumann JZ 1972, 1 ff.; Tiedemann Gutachten, S. C 51; ferner eingehend Bülte Vorgesetztenverantwortlichkeit, S. 88 f.
[10]
Vgl. Tiedemann Gutachten, S. C 51 ff.
1. Kapitel Einleitung: Vom Nutzen einer einheitlichen Darstellung des „Fiskalstrafrechts“› D. Entwicklungslinien des europäischen Strafrechts gegen Steuer- und Haushaltsdelikte
D. Entwicklungslinien des europäischen Strafrechts gegen Steuer- und Haushaltsdelikte
19
Die Verwandtschaft von Steuerhinterziehung und Betrugstaten zeigt sich ebenfalls sehr deutlich bei einem Blick über die Grenze. Das beginnt bereits bei der Formulierung von Tatbeständen, die wie in Österreich oder der Schweiz mit der Überschrift Abgaben- oder Steuerbetrugkeinen Zweifel an den Parallelen lassen.[1] In Österreich ist diese Entwicklung sehr deutlich geworden, weil der Gesetzgeber in der Reform des Finanzstrafrechts im Jahr 2012 das Steuerstrafrecht im Bereich der Qualifikationen – ähnlich wie in Deutschland – dem Betrugsstrafrecht angepasst hat. Hier lohnt es sich, die Frage zu stellen, ob ein künftiges europäisch harmonisiertes Steuerstrafrecht eher Züge des klassischen Betrugsstrafrechts tragen wird.[2] Noch deutlicher wird dieses Phänomen bei einem Blick auf das ungarische Steuer- und Haushaltsstrafrecht. Dort wurde kürzlich ein einheitlicher Tatbestand des Haushaltsbetrugs (§ 396 ungStGB) geschaffen.[3] Dabei wird in einer einheitlichen Strafvorschrift die Verletzung der öffentlichen Haushalte, sowohl der Ungarns als auch der internationaler Organisationen oder der Europäischen Union, unter Strafe gestellt.
20
Auch in der Politik der Europäischen Union kommt die einheitliche Bekämpfung von Haushaltsschädigungenbereits in den Begrifflichkeiten zum Ausdruck („Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union“).[4] So kommt etwa in der Richtlinie (EU) 2017/1371 vom 5.7.2017[5] ( Rn. 7) unmittelbar zum Ausdruck, dass zwar nicht auf Ebene des nationalen Strafrechts der Mitgliedstaaten, aber auf Unionsebene die Idee einer einheitlichen Betrugsbekämpfung vorherrscht, die die Steuerhinterziehung und sogar Bestechungsdelikte und Geldwäsche einschließt. Hierin wird ein einheitlicher Betrugstatbestand zugrundgelegt, der Einnahmen und Ausgaben der Union einheitlich vor Schädigung schützen soll.[6] Der Schutz der finanziellen Interessen und damit der Steuereinnahmen wie der Haushalte gleichermaßen dominiert seit Jahren – nicht nur die deutsche – die Diskussion über die Europäisierung des Strafrechts.[7]
[1]
Vgl. hierzu Leitner/ Schmoller Finanzstrafrecht 2012, S. 11 ff.; Leitner/ Brandl Finanzstrafrecht 2012, S. 113 ff.; ferner Leitner / Lehner NZWiSt 2015, 52 ff.
[2]
Vgl. Leitner/ Dannecker Finanzstrafrecht 2012, S. 61, 63.
[3]
Zu den Einzelheiten Jacsó NZWiSt 2014, 98 ff.
[4]
Vgl. hierzu nur Dannecker FS Kirchhof, S. 1809, 1811 m.w.N.
[5]
KOM (2912) 363 final.
[6]
Vgl. Leitner/ Dannecker Finanzstrafrecht, 2012, S. 61, 63.
[7]
Dannecker FS Kirchhof, S. 1809, 1811 m.w.N.
1. Kapitel Einleitung: Vom Nutzen einer einheitlichen Darstellung des „Fiskalstrafrechts“› E. Begriff des Fiskalstrafrechts und Notwendigkeit einer einheitlichen Darstellung
E. Begriff des Fiskalstrafrechts und Notwendigkeit einer einheitlichen Darstellung
21
Fasst man diese Bereiche des Wirtschaftsstrafrechts zusammen und bringt die Straftaten, die sich gegen die Staatshaushalte der deutschen Gebietskörperschaften und der Europäischen Union richten, unter einen Begriff, so sind dies die Fiskalstraftaten. Die Annäherung der Betrugs-, Untreue und Subventionsbetrugsdelikte einerseits und der Steuerstraftaten im weiteren Sinne andererseits ist in der Rechtsprechung des BGH bereits angelegt, und der europäische Vergleich – insbesondere mit Ungarn – macht deutlich, dass eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten dieser Delikte gegen den Haushalt besteht.
22
Hier soll eine geschlossene Darstellung des Fiskalstrafrechts erfolgen, weil diese einheitliche Darlegung im Überblick als notwendig angesehen werden kann. Bereits der Umstand, dass mittlerweile von Fiskalstrafrechtgesprochen werden kann, wenn das Strafrecht gegen Angriffe auf öffentliche Haushalte gemeint ist, legitimiert eine Gesamtdarstellung wie die vorliegende. Es muss zwar eingeräumt werden, dass, wenn von einer notwendigeneinheitlichen Darstellung gesprochen wird, diese mehr als einfach nur sinnvoll sein muss. Doch auch für diese Notwendigkeit im engen Sinne gibt es gute Gründe: Wenn Steuer- und Zollstrafrecht einerseits und Betrugs- bzw. Untreuestrafrecht andererseits sich gegenseitig beeinflussen, so verspricht eine Darstellung, die beide Bereiche in den Blick nimmt, den Mehrwert der Synergie.
23
Die Entwicklung des Steuerstrafrechts war bis vor wenigen Jahrzehnten von der des allgemeinen Vermögensstrafrechts weitgehend abgekoppelt, weil das Steuerstrafrecht entweder als Teil des Steuerrechts oder als Verwaltungsstrafrecht wahrgenommen wurde.[1] Zwar hat das Bundesverfassungsgericht diese Sichtweise bereits 1967 eindeutig abgelehnt, indem es die Unvereinbarkeit des Unterwerfungsverfahrensmit Art. 92 GG feststellte, in dem die Steuerverwaltung Kriminalstrafen verhängen konnte.[2] Dennoch dauerte es noch bis zum Beginn der Ära Harms am 5. Strafsenat des BGH bis das Steuerstrafrecht als Strafrecht ernst genommen wurde, eine realistische Verfolgungsgefahr für Steuerstraftäter entstand und eine gemeinsame Entwicklung dieses Bereichs des Strafrechts und damit auch eine Zusammenführung der Entwicklungslinien von Steuerstrafrecht und Vermögensstrafrecht begann.
24
Diese Synthese wird sich in den nächsten Jahren zwangsläufig noch weiter verstärken, weil das Steuerstrafrecht mehr mit dem Betrugs- und Untreuestrafrecht gemeinsam hat als mit den Straftaten, die bei der Entwicklung des Strafrechts im 19. Jahrhundert Pate gestanden haben.[3] Man könnte die Gemeinsamkeit letztlich auf einen einfachen Nenner herunterbrechen: Dem Steuerstraftäter geht es ebenso um das Geld der Allgemeinheit wie dem Täter eines Subventionsbetrugs oder einer Haushaltsuntreue. Auch wenn diese Gleichsetzung aller Straftaten gegen das Vermögen vergröbert, so ist sie dennoch dem Grunde nach hinreichend plausibel, um diese Straftaten gemeinsam und unter Bezugnahme aufeinander darzustellen. Dieser innere Zusammenhang dieser Straftaten dürfte einer der Gründe sein, warum auch Tiedemann in seinem Lehrbuch zum Wirtschaftsstrafrecht (5. Aufl. 2017) § 17 das „Strafrecht der öffentlichen Finanzwirtschaft“ in einem einheitlichen Abschnitt darstellt.
25
Für das gesamte (Wirtschafts-)Strafrecht gelten die gleichen Regeln des Verfassungsrechts, der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuchs und die allgemeinen Lehren des Strafrechts.[4] Jedoch wirft das hier als Fiskalstrafrecht bezeichnete Sanktionsrechtspezifische Probleme auf, die sich daraus ergeben, dass die maßgeblichen Tatbestände stark normativ geprägt sind (Steuerhinterziehung, Untreue etc.) oder Blankettverweisungen (§§ 379 ff. AO) enthalten.[5] Insbesondere diese Normativierungen bringen bei der Anwendung des Allgemeinen Teils grundlegende Schwierigkeiten mit sich. So ist die Reichweite von Art. 103 Abs. 2 GG bei diesen Tatbeständen nicht abschließend geklärt, und insofern stellen sich im Steuer- und Zollstrafrecht und bei Untreue und Betrugsstraftaten sehr ähnliche Probleme.[6] Heftig umstritten ist nach wie vor die Behandlung von Rechtsirrtümern (u.a. Kap. 8 Rn. 64; Kap. 22 Rn. 68) oder die Bestimmung von Garantenstellungen (u.a. Kap. 7 Rn. 58 ff.; Kap. 11 Rn. 58). Hier ergibt sich aus der parallelen Aufarbeitung in einem Band die Möglichkeit des Verweises, um sowohl die Probleme als auch die Lösungsansätze zu verdeutlichen. Diese gilt auch für Fragen, die unmittelbar die Straftatbestände des Besonderen Teils betreffen, wie z.B. die Bestimmung des Schadens, insbesondere seiner Normativierung.
Читать дальше