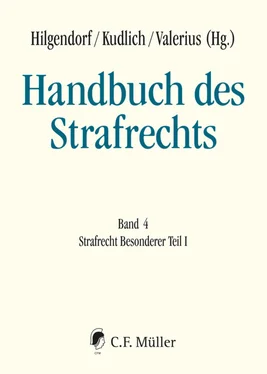88
Ein solches Recht zur Körperverletzung kann zum einen aufgrund gesetzlicher Rechtsfertigungsgründebestehen. Hier ist insbesondere an die Notwehr (§ 32 StGB, § 227 BGB) und das Festnahmerecht (§ 127 Abs. 1 StPO) zu denken. Weiterhin kann eine Körperverletzung bei Handeln durch Amtsträger*innen durch öffentlich-rechtliche Eingriffs- und Befugnisnormen gerechtfertigt sein ( Rn. 115 ff.). Zum anderen können ungeschriebene(durch Gewohnheitsrecht anerkannte) Rechtfertigungsgründe das Handeln rechtfertigen. Dies ist der Fall, wenn eine rechtfertigende Einwilligung oder eine Pflichtenkollision vorliegen. Der Einwilligung kommt im Rahmen der Körperverletzungsdelikte eine besondere Bedeutung zu ( Rn. 92 ff.).
89
Besondere Relevanz entfaltet bei den Körperverletzungsdelikten der Rechtfertigungsgrund der Notwehr(§ 32 StGB, § 227 BGB). Diese Erlaubnisnorm enthält das Recht der einzelnen Person, sich oder einen*eine Dritte*n gegen einen rechtswidrigen Angriff in einer an sich verbotenen Weise zu verteidigen, indem die Individualrechtsgüter der angreifenden Person verletzt werden.[328] Als Sinn und Zweck der Norm wird überwiegend der Schutz von Rechtsgütern sowie das allgemeine Rechtsbewährungsprinzip genannt.[329] Eine Handlung ist dann durch Notwehr gerechtfertigt, wenn ein gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff vorliegt (sog. Notwehrlage) und die angegriffene Person sich auf erforderliche und gebotene Art und Weise dagegen verteidigt (sog. Notwehrhandlung). Ein Angriff gilt auch dann als rechtswidrig, wenn die angreifende Person von einem vermeintlichen Festnahmerecht nach § 127 Abs. 1 StPO ausgeht, tatsächlich aber kein dringender Tatverdacht besteht.[330] Die Verteidigungshandlung muss von einem Verteidigungswillen getragen sein und sich gegen Rechtsgüter der angreifenden Person richten (ansonsten evtl. § 34 StGB). Dabei ist die Person, die rechtswidrig angegriffen wird, grundsätzlich berechtigt, dasjenige Abwehrmittel zu wählen, das eine endgültige Beseitigung der Gefahr gewährleistet. Demnach kann auch die sofortige, das Leben der angreifenden Person gefährdende Notwehrhandlung gerechtfertigt sein. Die Notwehr als Rechtsfertigungsgrund kommt selbst bei der schweren Körperverletzung nach § 226 StGB und bei Tötungsdelikten in Betracht, wenn zur Abwehr massiver Angriffe ähnlich massive Verteidigungshandlungen notwendig waren, und im Grundsatz unabhängig davon, ob der*die sich Verteidigende die Folge fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat.[331] Einschränkungen des Notwehrrechts ergeben sich jedoch bei Absichtsprovokationen, den Angriffen von erkennbar schuldlos Handelnden, ggf. auch bei völlig unerheblichen Angriffen und bei Angriffen in engen persönlichen Beziehungen.[332] Die Notwehrhandlung kann nach den Umständen des Einzelfalles hier sozialethisch („gebotene Notwehrhandlung“) soweit eingeschränkt werden, dass zunächst aus den genannten Billigkeitsgründen, insbesondere bei schuldhaft provozierter Notwehrlage, zunächst ausgewichen werden muss oder nur Schutzwehr geleistet werden darf, bevor es legitim ist, final zur Trutzwehr überzugehen.[333] Doch auch hier müssen substanzielle Einbußen, wie oftmals bei Körperverletzungsdelikten, im Zweifel nicht hingenommen werden.[334]
90
Ein eigenständiger Rechtfertigungsgrund in Form des sog. Züchtigungsrechtsder Eltern kann heutzutage nicht mehr angenommen werden.[335] Nach früher h.M. war das Handeln der Erziehungsberechtigten, die ihren minderjährigen Kindern von einem bestimmten Erziehungszweck getragene körperliche Misshandlungen zufügten, nicht rechtswidrig.[336] Das Züchtigungsrecht war aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen oder als Gewohnheitsrecht auch für Lehrer*innen anerkannt.[337] Der Rechtfertigungsgrund entfiel endgültig mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung im Jahr 2000.[338] Durch das Gesetz wurde der § 1631 Abs. 2 BGB grundlegend geändert.[339] Der Wortlaut lässt für Zweifel keinen Raum mehr: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ Daran ändert auch das Erziehungsrecht aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG nichts.[340] Jede die Bagatellgrenze überschreitende Handlung bedeutet daher, dass der Tatbestand erfüllt ist. Die körperliche Züchtigung von Kindern ist heute kein sozialadäquates Verhalten mehr.[341]
91
Besonderheiten bestehen bei der Rechtfertigung für den Tatbestand des § 231 StGB, der nicht nur das Leben und die Gesundheit der durch die Schlägerei oder den Angriff tatsächlich verletzten Person schützt, sondern auch aller solcher Personen, die unmittelbar oder mittelbar durch die Schlägerei oder den Angriff gefährdet werden. Angesichts dessen sind die von § 231 StGB geschützten Rechtsgüter nicht umfassend disponibel,[342] weshalb eine rechtfertigende Einwilligung eines oder aller Beteiligten regelmäßig nicht in Betracht kommt.[343] Die durch die Verwirklichung des § 231 StGB nicht kalkulierbare Gefährdung für mehrere Personen dürfte außerdem regelmäßig gegen die guten Sitten i.S.v. § 228 StGB verstoßen.[344] Eine Rechtfertigung wegen Notwehr scheidet bei § 231 StGB ebenso regelmäßig aus, da § 32 StGB Verteidigungshandlungen nur gegenüber einer angreifenden Person legimitiert, nicht jedoch die Verletzung von Körper und Gesundheit anderer beteiligter Personen.[345] Daher kann zwar ein konkretes Körperverletzungs- oder Tötungsdelikt im Rahmen einer Schlägerei ggf. wegen Notwehr gerechtfertigt sein. § 231 StGB als abstraktes Gefährdungsdelikt pönalisiert jedoch die gesamte Beteiligung an dem Geschehen. Eine Rechtfertigung dessen kann nur in Betracht kommen, wenn die Beteiligung insgesamt durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt ist und nicht nur eine Teilhandlung im Rahmen dessen.[346]
2. Einwilligung und ihre Grenzen
92
Die Einwilligung ist als ungeschriebener Rechtfertigungsgrund allgemein anerkannt.[347] Sie ist bei den Körperverletzungsdelikten von herausragender Bedeutung und durch die spezielle Regelung des § 228 StGB besonders ausgeformt. Der Rechtfertigungsgrund setzt objektiv ein dispositionsfähiges Rechtsgut voraus, was hier mit der körperlichen Unversehrtheit gegeben ist, solange kein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt (§ 228 StGB). Weiterhin muss eine Einwilligungserklärung vorliegen, die frei von Willensmängeln ist. Der*die Erklärende muss einwilligungsfähig sein. Subjektiv muss der*die Verletzende in Kenntnis der Einwilligung handeln.
93
§ 228 StGB – der nach ganz überwiegender Auffassung für alle Körperverletzungsdelikte gilt[348] – schränkt die mögliche Reichweite der rechtfertigenden Einwilligung ein. Es handelt sich um eine gesetzlich bestimmte Ausnahme von der allgemeinen Einwilligungsregel.[349] § 228 StGB regelt also nicht die unrechtsausschließende Wirkung der Einwilligung, sondern setzt diese vielmehr voraus und normiert nur die Grenzen einer solchen Einwilligung für den Fall der Körperverletzungsdelikte. Danach wirkt eine Einwilligung dort nicht rechtfertigend, wo die Tat trotz selbiger gegen die „ guten Sitten“ verstößt. Hierunter wird wie im Zivilrecht das „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“ verstanden. Als unbestimmter Rechtsbegriff und in autonomer strafrechtlicher Bewertung bedarf die Wendung von den guten Sitten einer verfassungskonformen Auslegung, welche insbesondere am Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG zu messen ist.[350]
94
Die Rechtsprechung erkannte dies schon in den 1950er Jahren und befand, § 228 StGB müsse eng ausgelegt werden, „um im Rechtsstaat erträglich zu sein“[351]. Bis in die 1990er Jahre hinein wurde bei der Auslegung der sog. Zweckansatzverfolgt, d.h. es kam bei der Bestimmung der Sittenwidrigkeit auf den verfolgten Zweck der Beeinträchtigungen an, also auf die Beweggründe und Ziele, die mit der Verletzung verfolgt werden.[352] Seit Anfang der 2000er Jahre zeichnet sich hier eine Wende in der Rechtsprechung ab, vom Zweckansatz hin zur sog. Rechtsgutslösung.[353] Danach steht nicht mehr der angestrebte Zweck der Körperverletzung im Vordergrund, sondern die Intensität der Handlung und ihrer Folgen.[354] Maßgeblich ist laut der neueren Rechtsprechung der Umfang der hinzunehmenden Körperverletzung und der Grad der damit verbundenen Leibes- oder Lebensgefahr.[355] Dies soll durch vorausschauende objektive Betrachtung aller maßgeblichen Umstände bestimmt werden.[356] Dementsprechend soll für den Fall, dass durch die Körperverletzung eine konkrete Lebensgefahr verursacht wird, stets von einem Verstoß gegen die guten Sitten auszugehen sein.[357] Ebenso seien Eingriffe in die Dispositionsbefugnisse des*der Rechtsgutsträgers*Rechtsgutsträgerin auch dann legitim, wenn die zu erwartenden Verletzungen an die in § 226 StGB geregelten erheblichen Beeinträchtigungen heranreichen.[358] Hingegen ist die Einwilligungen von Gefangenen in durchgeführte Tätowierungen auch dann nicht wegen Sittenwidrigkeit unwirksam, wenn in der JVA ein disziplinarrechtlich abgesichertes Tätowierverbot besteht.[359]
Читать дальше