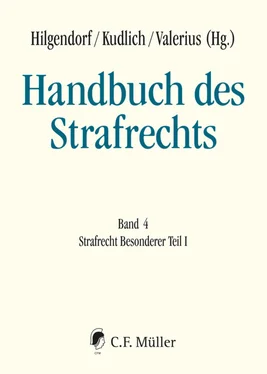68
Hinsichtlich des Erfolgsunrechtskönnen die Schwere, die Anzahl und das Ausmaß der verursachten Verletzungen strafschärfende Gründe sein.[255] Auch die zu erwartende Dauer des zugefügten Leids und der Umfang der Beeinträchtigungen ist hier bedeutsam;[256] beispielsweise soll bei § 226 StGB ein langjährig zu erwartendes Leiden eines nur neunmonatigen Kindes strafschärfend sein.[257] Dabei soll es auch auf die individuelle Bedeutsamkeit der erlittenen Verletzungen ankommen (z.B. Gehörverlust bei einem Dirigenten[258]). Auch können übermäßig nachteilige Tatfolgen, die nicht bereits tatbestandlich verankert sind, berücksichtigt werden, etwa zumindest vorhersehbare seelische Schäden bei § 226 StGB.[259] Sind die Verletzungen jedoch nur leicht, so kann dies strafmildernd zu berücksichtigen sein.[260]
69
Im Rahmen von Fahrlässigkeitist besonderes Augenmerk auf das Maß der Pflichtwidrigkeit und auf ein etwaiges Mitverschulden des Opfers (z.B. eigene Verstöße gegen Vorsichtsmaßnahmen) zu legen.[261] Ohnehin kann das Opferverhalten eine strafmildernde Rolle spielen, gerade bei Provokationshandlungen.[262] Auch wenn das Opfer kein eigenes Bestrafungsinteresse bekundet, kann dies strafmildernd wirken.[263] Bei Körperverletzungsdelikten erscheint zudem die Möglichkeit eines Täter*in-Opfer-Ausgleichs oder einer sonstigen Schadenswiedergutmachung oftmals nahezuliegen, was nach § 46 Abs. 2 StGB in die Zumessungsentscheidung einbezogen werden kann.
70
Das einschlägig straffällige Vorleben des*der Täters*Täterin soll bei Wiederholungstätern*Wiederholungstäterinnen von Körperverletzungsdelikten besonders strafschärfend einzubeziehen sein.[264] Strafmildernd kann bei § 231 StGB ein Deeskalationsverhalten durch das Entwinden eines Messers eines*einer an der Schlägerei Beteiligten gewertet werden.[265] Ein Migrationshintergrund hat auch bei Körperverletzungsdelikten per se keinen Einfluss auf die Strafzumessung.[266] Alkoholisierung als häufiger Täter*innenzustand bei Körperverletzungsdelikten ist bei der Vorwerfbarkeit der Tat zu berücksichtigen, auch unterhalb der Grenzen der §§ 20, 21 StGB. Eine Strafmilderung nach § 21 StGB kommt nur in Frage, wenn der*die Täter*in im Unwissen war, dass er*sie unter massiver Alkoholisierung zu Körperverletzungshandlungen tendiert.[267]
71
Das Doppelverwertungsverbotdes § 46 Abs. 3 StGB schließt Erwägungen aus, die z.B. die Nichtachtung der Schutzgüter der §§ 223 ff. StGB besonders bestrafen wollen oder pauschal die Gefährlichkeit der Tat strafschärfend berücksichtigen, obwohl dies schon von einer Modalität, beispielsweise des § 224 Abs. 1 StGB, erfasst wird.[268]
II. Besondere Fragestellungen auf der Ebene des Tatbestands
72
Eine grundlegende konzeptionelle Frage der Körperverletzungsdelikte und insbesondere des § 223 Abs. 1 StGB besteht darin, in welchem Mindestmaß die körperliche Unversehrtheit bzw. die Gesundheit tangiert sein müssen, um von einem strafrechtlich relevanten Eingriff in das Schutzgut sprechen zu können. Umgekehrt formuliert bedarf es der Klärung, welche bagatellhaften Handlungen von den Tatbeständen nicht erfasst sein sollen.
73
Bei der körperlichen Misshandlung im Rahmen von § 223 Abs. 1 StGB wird dies in der Form umgesetzt, dass das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblichbeeinträchtigt worden sein müssen. Um Bagatellfälle von der Strafbarkeit auszuschließen, wird eine Erheblichkeitsgrenze gesetzt, die aber ihrerseits präzisiert werden muss. Um Rechtssicherheit und insbesondere Vorhersehbarkeit für Bürger*innen zu schaffen, richtet sich die Erheblichkeit nicht nach dem subjektiven Empfinden der verletzten Person, sondern wird aus Sicht eines*einer objektiven Betrachtenden bestimmt.[269] Maßgeblich für die Beurteilung der Erheblichkeit kann dabei die Dauer sowie die Intensität der Einwirkung sein.[270] Im Einzelnen sind etwa ein Ekelgefühl sowie das Empfinden von Angst als unerheblich anzusehen.[271] Ebenso genügen psychovegetative Vorgänge, wie Schweißausbrüche, Herzklopfen oder Durchfall, grundsätzlich nicht, wenn sie nur vorübergehend sind.[272] Selbst wenn das Zufügen von Stromstößen regelmäßig erheblich ist, reicht das bloße „Kribbeln in Beinen und Füßen“, hervorgerufen durch einen in das Badewasser geworfenen Fön, nicht aus.[273] Auf der anderen Seite können der Schmerz nach einer Ohrfeige[274] oder aber Verunstaltungen des Körpers, z.B. durch Abschneiden der Haare, eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung darstellen.[275] Da es sich bei weniger intensiven Eingriffen oft um Grenzfälle handelt, bedarf es einer zusammenfassenden Bewertung aller Einzelfallumstände.
74
Anlass zur Diskussion bietet auch die fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB) im Straßenverkehr. Für einfache Körperverletzungen in diesem Bereich wird erwogen, den § 229 StGB um die Voraussetzung der „Leichtfertigkeit“ zu ergänzen und so die Strafbarkeitsschwelle anzuheben.[276] Andere Stimmen fordern demgegenüber sogar die Aufhebung der Strafbarkeit in diesem Bereich.[277] Für die Entkriminalisierung wird ins Feld geführt, dass bei der Bestrafung von jedenfalls leichten, durch geringfügiges Fehlverhalten entstandenen Körperverletzungen kein Strafzweck erfüllt würde. Weder General- noch Spezialprävention seien betroffen, da die fahrlässige Körperverletzung nicht von einer Willensbildung getragen wird und auch nicht davon auszugehen ist, dass durch partielle Entkriminalisierung die Rechtstreue der Bevölkerung abnehmen würde.[278] Auch ist die Teilnahme am Straßenverkehr insofern eine besondere Situation, als dass bei jeder fahrlässigen Handlung die Gefahr besteht, eigene Rechtsgüter zu verletzen. Der Anreiz, sich fahrlässig zu verhalten, sei so von Anfang an sehr niedrig.[279] Schließlich wird angeführt, dass die Anforderungen an die Fahrer*innen zu hoch seien und es allein vom Zufall abhänge, ob ein Sorgfaltsverstoß im Straßenverkehr zur Strafbarkeit führe.[280] Dem lässt sich entgegnen, dass der Erfolgseintritt bei Fahrlässigkeitsdelikten immer nur das Ergebnis der gefahrgeneigten Handlung ist und die strafrechtliche Vorwerfbarkeit sich bereits auf die Schaffung einer solchen Gefahr bezieht.[281] Der Gesetzgeber hat sich demgegenüber bislang dafür entschieden, der Problematik auf prozessualer Ebene zu begegnen und die Strafverfolgung zu beschränken.[282] Auf Exekutivebene wurde Mitte der 1990er Nr. 243 Abs. 3 RiStBV dahingehend geändert, dass das öffentliche Interesse bei einer im Straßenverkehr begangenen Körperverletzung nicht grundsätzlich zu bejahen sei.[283] Problematisch ist allerdings die unterschiedliche Handhabung der verschiedenen Möglichkeiten durch die Strafjustiz.[284] Eine bundesweit einheitliche Entkriminalisierung bzw. zumindest Steuerung der Verfahrenszahlen in diesem Bereich kann nur durch eine besondere gesetzliche Regelung im materiellen Strafrecht oder Verfahrensrecht geschaffen werden.
2. Eigenverantwortliche Selbstgefährdung und
einverständliche Fremdgefährdung
75
Da die §§ 223 ff. StGB nur die Verletzungen anderer Personen erfassen, ist die Selbstverletzung grundsätzlich straflos (siehe oben Rn. 31). Auf der Ebene des Tatbestandes führt dies zu der Problematik, dass das Ermöglichen oder Fördern einer eigenverantwortlich gewollten und verwirklichten Selbstgefährdung – die mangels tauglicher Haupttat grundsätzlich straflos ist – von der strafbaren, möglicherweise aber einverständlichen Fremdgefährdung abzugrenzen ist. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH erfüllt „eine eigenverantwortlich gewollte und verwirklichte Selbstgefährdung“ grundsätzlich nicht den Tatbestand eines Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts, wenn sich das vom Opfer bewusst eingegangene Risiko realisiert. „Wer eine solche Gefährdung veranlasst, ermöglicht oder fördert, kann daher nicht wegen eines Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts verurteilt werden; denn er nimmt an einem Geschehen teil, welches – soweit es um die Strafbarkeit wegen Tötung oder Körperverletzung geht – kein tatbestandsmäßiger und damit strafbarer Vorgang ist.“[285] Fremdgefährdung meint hingegen Fälle, in denen sich eine Person nicht selbst gefährdet, sondern sich im Bewusstsein des Risikos von einer anderen Person gefährden lässt.[286] Exemplarisch für die sich daraus ergebenden Abgrenzungsprobleme sind Konstellationen, in denen gefährliche Wirkstoffe von anderen bezogen und anschließend wissentlich eingenommen werden – vor allem Medikamente und sonstige Betäubungsmittel, auch im Rahmen der Sterbehilfe – und Fälle, in denen gemeinsame Unternehmungen zu Schädigungen Einzelner führen, wie z.B. Unfälle bei Autorennen mit Mitfahrer*innen.
Читать дальше