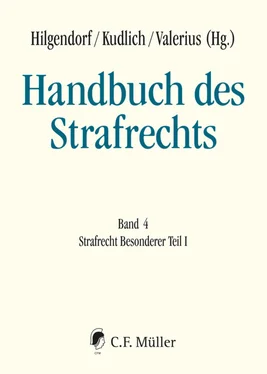5
Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits mit der Frage nach der Grundrechtsträgerschaft des ungeborenen Lebens befasst. Dabei gilt es laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Sinne von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 GG nicht nur das menschliche Leben nach seiner Geburt, sondern auch den Embryo bzw. Fötus zu schützen.[24] So hält das Bundesverfassungsgericht in seinem Leitentscheid aus dem Jahr 1993 fest: „Ihren Grund hat diese Schutzpflicht in Art. 1 Abs. 1 GG, der den Staat ausdrücklich zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde verpflichtet; ihr Gegenstand und – von ihm her – ihr Maß werden durch Art. 2 Abs. 2 GG näher bestimmt“.[25] Darüber hinaus weist das Bundesverfassungsgericht darauf hin, dass „wo menschliches Leben existiert, … ihm [auch] Menschenwürde zu[kommt]“, d.h. es darf nicht zwischen ungeborenem und geborenem Leben unterschieden werden.[26] Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist folglich nicht nur dem bereits geborenen Menschen, sondern ebenso dem ungeborenen Leben die Menschenwürde zuzuerkennen.[27] Allerdings hat es das Bundesverfassungsgericht bisher offengelassen, ob der Grundrechtsschutz Ungeborener bereits im Zeitpunkt der Kernverschmelzung oder erst mit erfolgter Nidation beginnt.[28] Eine diesbezügliche Leitentscheidung wäre allerdings insbesondere im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit des Embryos in vitro wünschenswert wie auch geboten.[29]
6
Ebenso wie die Menschenwürde stellt auch das Lebensrecht im Sinne von Art. 2 Abs. 2 GG ein Grundrecht dar.[30] Auch dem Lebensrecht kommt eine fundamentale Bedeutung zu.[31] So halten Art. 2 Abs. 2 S. 1 und S. 3 GG fest, dass jeder ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat (S. 1) und dass nur kraft eines Gesetzes in diese Rechte eingegriffen werden darf (sog. Gesetzesvorbehalt, S. 3). Die Lehre ist sich einig, dass dem menschlichen Leben mit vollendeter Geburt zweifelsohne eine diesbezügliche Grundrechtsträgerschaft zukommt.[32] Da aber im Strafrecht das menschliche Leben bereits mit Einsetzen des Geburtsaktes (siehe Rn. 15) beginnt, rechtfertigt es sich nach allgemeinem Dafürhalten, dass bereits in diesem Zeitpunkt die Schutzwirkungen von Art. 2 Abs. 2 GG greifen.[33] Uneinigkeit besteht allerdings hinsichtlich der Frage, ob auch dem ungeborenen menschlichen Leben ein Lebensrecht bzw. eine Grundrechtsträgerschaft des Lebensrechts zugestanden werden soll und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt. Einige Lehrmeinungen setzen sich für ein Lebensrecht und eine Grundrechtsträgerschaft des intrakorporalen Embryos ab dem Zeitpunkt der Konzeption ein, andere für eine Schutzbedürftigkeit erst mit erfolgter Nidation.[34] Für den extrakorporal gezeugten Embryo kann diese Streitfrage allerdings – wie bereits erwähnt – nicht abschließend beantwortet werden.[35]
7
Auch nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bedingt die verfassungsrechtliche Schutzpflicht der Menschenwürde, dass der Staat das ungeborene Leben nicht nur vor unmittelbaren staatlichen Eingriffen, sondern auch vor rechtswidrigen Eingriffen seitens anderer bewahrt.[36] Dabei nimmt laut Bundesverfassungsgericht mit zunehmender Bedeutung des jeweiligen Rechtsguts auch die diesbezügliche Schutzverpflichtung des Staates zu.[37] Da das Rechtsgut des menschlichen Lebens als Grundlage anderer Grundrechte von elementarer Bedeutung ist, wird auch seinem Schutzbedürfnis ein hoher Stellenwert zugemessen.[38]
8
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage nach der Grundrechtsträgerschaft des werdenden Lebens im Sinne von Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 GG stößt seitens der Lehrmeinungen zu Recht auf Kritik.[39] Unter anderem wird angeführt, dass der Verfassungswortlaut streng genommen nur „die Würde des Menschen“ schütze, wobei zumindest aus strafrechtlicher Sicht erst mit Einsetzen der Geburtswehen (im Zivilrecht sogar erst nach erfolgter Geburt) von einem Menschen gesprochen werden könne.[40] Insofern sei nicht ersichtlich, weshalb sich die Rechtsprechung auf Verfassungsebene gegen eine differenziertere Schutzwürdigkeit Ungeborener sowie gegen die Befürwortung eines abgestuften Lebensschutzes Ungeborener ausspreche.[41] Unter den Voraussetzungen von § 218a StGB wird der Abbruch einer Schwangerschaft seitens des Gesetzgebers ja als nicht tatbestandsmäßig bzw. nicht rechtswidrig eingestuft.[42] Im Lichte der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung stehe dies in einem deutlichen Widerspruch zu den Verfassungsnormen von Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 GG.[43] Denn durch die verfassungsrechtlich postulierte Unantastbarkeit der Menschenwürde könnten keinerlei Eingriffe in die Würde des Menschen als gerechtfertigt bzw. zulässig angesehen werden, auch nicht ein Schwangerschaftsabbruch.[44] Konkret bedeutet dies, dass ein Schwangerschaftsabbruch deshalb grundsätzlich als unzulässig betrachtet werden müsste.[45] Ein Ausweg aus dieser verfassungsrechtlichen Kontroverse lässt sich folglich nur auf dem Weg der Gesetzesauslegung im Sinne einer objektiv-teleologischen Auslegung finden. Denn richtigerweise ist zu (hinter-)fragen, welchen Zweck der besagten Verfassungsnormen nach dem heutigen Wertungshorizont unter Einbezug der gegenwärtigen Gesetzeslage (hic et nunc-Betrachtung) beigemessen werden sollte.[46] Mit Blick auf die strafrechtlichen Regelungsnormen zum Schwangerschaftsabbruch müsste also unter dem Gesichtspunkt der objektiv-teleologischen Auslegung folgerichtig ein unantastbarer Würdeschutz und ein umfassendes Lebensrecht Ungeborener verneint, hingegen eine abgestufte Schutzwürdigkeit der Leibesfrucht bejaht werden.[47] Selbst das Bundesverfassungsgericht ließ in seinem ersten Leitentscheid zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs verlauten: „Der Gesetzgeber ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die gleichen Maßnahmen strafrechtlicher Art zum Schutze des ungeborenen Lebens zu ergreifen, wie er sie zur Sicherung des geborenen Lebens für zweckdienlich und geboten hält“.[48] Das Bundesverfassungsgericht weist auch darauf hin, dass der verfassungsrechtlich normierte Schutzumfang nach Art. 2 GG lediglich eine Zielnorm darstellt, die Ausgestaltung des Lebensschutzes im Einzelnen aber dem Gesetzgeber obliegt.[49] Zudem schließt das Bundesverfassungsgericht aus dem Umstand, dass dem Grundgesetz selbst kein Hinweis auf eine allfällige Abstufung des Lebensrechts entnommen werden kann, auf das Zugeständnis eines verfassungsrechtlich gleichwertigen Schutzumfangs des ungeborenen und des geborenen menschlichen Lebens.[50] So hält das Bundesverfassungsgericht in seiner zweiten Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruchs-Entscheidung fest: „Das Grundgesetz enthält für das ungeborene Leben keine vom Ablauf bestimmter Fristen abhängige, dem Entwicklungsprozess der Schwangerschaft folgende Abstufungen des Lebensrechts und seines Schutzes“.[51] Dieses Schweigen des Gesetzgebers zur Frage eines abgestuften Lebensschutzes kann aber im Sinne eines argumentum e contrario geradezu auch für die Zulässigkeit eines abgestuften Lebensschutzes herangezogen werden.
II. Schutzumfang der Schwangeren nach dem Grundgesetz und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
9
Als besonders problematisch erweist sich das Zugeständnis eines Lebensrechts Ungeborener im Hinblick auf die der Schwangeren verfassungsrechtlich gewährleisteten bzw. zustehenden Grundrechte. Insbesondere die Achtung der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) sowie das Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) sind im Zusammenhang mit dem Diskurs über einen absoluten Lebensschutz Ungeborener von Relevanz.[52] Namentlich bei einer Kollision zwischen den Grundrechten eines Ungeborenen und denjenigen einer Schwangeren drängt sich die Frage auf, welchem Grundrechtsträger der Vorrang einzuräumen ist. Das Bundesverfassungsgericht hält in seinem zweiten Entscheid zum Schwangerschaftsabbruch aus dem Jahre 1993 fest, dass es sich beim Ungeborenen „um individuelles, in seiner genetischen Identität und damit in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bereits festgelegtes, nicht mehr teilbares Leben [handelt], das im Prozess des Wachsens und Sich-Entfaltens sich nicht erst zum Menschen, sondern als Mensch entwickelt“.[53] Deshalb gilt es gemäss Bundesverfassungsgericht, dieses Leben von Beginn seiner Existenz an zu achten und zu schützen, weshalb auch Ungeborenen ein eigenes Lebensrecht zu gewährleisten ist.[54] In diesem Sinne lässt es auch verlauten, „dass der Schwangerschaftsabbruch für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen wird und demgemäss rechtlich verboten ist“.[55] Weiter folgert das Bundesverfassungsgericht, dass kein Durchgriff der Grundrechte der Schwangeren gegenüber dem gesetzlich normierten Verbot des Schwangerschaftsabbruchs erfolgt.[56] Konkret bedeutet dies, dass grundsätzlich eine auf dem Grundgesetz basierende Rechtspflicht der Schwangeren zur Austragung des Kindes im Mutterleib besteht.[57] Zusammenfassend steht folglich die Schutzwürdigkeit des ungeborenen menschlichen Lebens laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts deutlich im Vordergrund.[58] Trotzdem relativiert auch das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung dahingehend, dass dem Lebensschutz des Embryos in vivo kein absoluter Vorrang zukommen soll, vielmehr soll gemäss Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG in das Lebensrecht eines jeden auf Grundlage eines Gesetzes eingegriffen werden können.[59] Dabei muss die Schutzbedürftigkeit des Lebens Ungeborener gegenüber anderweitigen, mit dieser kollidierenden, schützenswerten Rechtsgütern abgewogen werden.[60] Im Zusammenhang mit der Thematik des Schwangerschaftsabbruchs gilt es insbesondere das Lebensrecht eines Ungeborenen und die Rechtsgüter einer Schwangeren, namentlich das ihr zustehende Recht auf Leben bzw. körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) oder ihre Persönlichkeitsrechte (Art. 2 Abs. 1 GG), gegeneinander abzuwägen.[61] So kommt auch das Bundesverfassungsgericht zum Schluss, dass es im Falle einer Grundrechtskollision zwischen den Rechtsgütern der Schwangeren und denjenigen des ungeborenen Kindes in Ausnahmesituationen womöglich geboten wäre, der Schwangeren eine Rechtspflicht zur Austragung der Schwangerschaft nicht aufzuerlegen.[62] Eine Definition dieser sog. „Ausnahmesituationen“ wird vom Bundesverfassungsgericht allerdings in die Hände der Legislative gelegt.[63] Folgerichtig muss in Fällen absoluter Unzumutbarkeit einer Schwangerschaft gegenüber der Schwangeren ein Abbruch vorgenommen werden dürfen bzw. als zulässig erachtet werden. Als Fälle der Unzumutbarkeit werden gemeinhin Konstellationen erachtet, in denen eine Fortdauer der Schwangerschaft das Leben der Schwangeren ernsthaft gefährden, auf unerträgliche Art und Weise deren Gesundheit beeinträchtigen oder schließlich gegen die Würde der Schwangeren verstoßen würde, was vor allem bei einer Vergewaltigung zutreffen dürfte.[64] Allerdings ist diese Aufzählung nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht abschließend, vielmehr hat sich der Gesetzgeber bei einer Festlegung von Ausnahmesituationen am Kriterium der Unzumutbarkeit der Schwangerschaft zu orientieren.[65]
Читать дальше