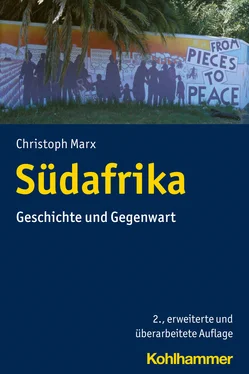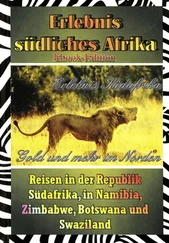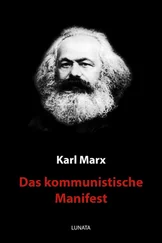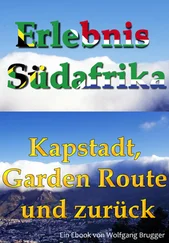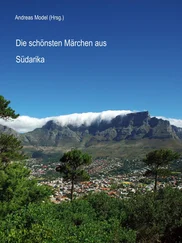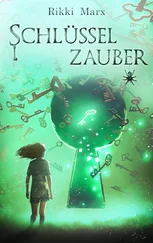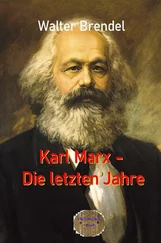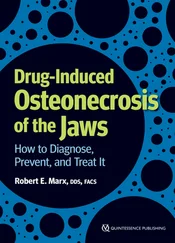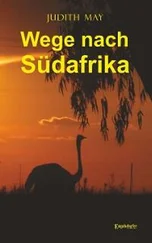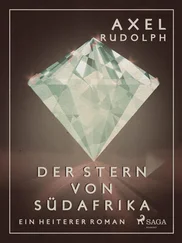Die Rechtsordnung Südafrikas beruhte auf dem römisch-holländischen Recht, wozu die spezifischen Rechtsartikel kamen, die die VOC in ihrem Einflussbereich im Indischen Ozean, vor allem in Batavia, entwickelt hatte. In der Kapkolonie galten zusätzlich noch die vom Politischen Rat erlassenen Rechtsverordnungen, die sogenannten Plakkaten, eine ergänzende lokale Rechtsgrundlage. Oberste Zuständigkeit für das Recht hatte der Fiscaal, dessen Amt nach dem des Gouverneurs und seines Stellvertreters den dritthöchsten Rang in der Kolonie beanspruchte. Er war unabhängig, weil er direkt an die Heren XVII berichten konnte und von ihnen Weisungen erhielt, d. h. er musste nicht über den Gouverneur oder über Batavia kommunizieren. Seine Funktion war die eines Staatsanwalts und Anklägers. Das Amt bot Chancen für den Aufbau einer unabhängigen Machtstellung, wobei der Fiscaal auch über zahlreiche Bereicherungsmöglichkeiten verfügte. Die eigentliche Rechtsprechung oblag dem Justizrat, dessen Vorsitz zuerst der Gouverneur, später sein Stellvertreter innehatte. Dieses Gericht war für Strafprozesse und alle schwerwiegenden Fälle zuständig, in denen es um einen Streitwert von mehr als 100 Rixdollar (Reichstaler) ging. Daneben gab es einen Gerichtshof für Bagatellfälle, aber keine eigenen Sklavengerichte. Denn Sklaven und Bürger wurden von denselben Gerichten be- und verurteilt. In den Distrikten im Hinterland war der Landdrost als oberster Verwaltungsbeamter der VOC auch der Vorsitzende der lokalen Gerichte, die sich aus den gewählten Heemraden – meist wohlhabende Farmer – konstituierten. Diese Lokalgerichte unterstanden jedoch den Weisungen und der Aufsicht des Justizrates. Sie durften zudem nur Fälle von untergeordneter Bedeutung und von einem Streitwert bis zu 50 Rixdollar behandeln. Die Möglichkeiten des Landdrost wie des Fiscaal, Verhaftungen vorzunehmen, waren eingeschränkt und wurden vom Justizrat kontrolliert. Ebenso wurde die Folter als Befragungsmethode eher selten angewandt, galt aber wie in Europa prinzipiell als legitim.
Die umfassende Kontrolle von oben schloss kirchliche Angelegenheiten ein. Da nur die Reformierte Kirche zugelassen war und die Prediger und Pastoren Angestellte der Kompanie waren, verfügte die Kirche im Gegensatz zu den Niederlanden selbst über keinerlei Autonomie. Vor allem die Gemeinden hatten keine Möglichkeit, ihren Pastor selbst zu wählen. Kapstadt besaß keine Stadtrechte, es galt sogar für lange Zeit nicht einmal als Stadt. Die Verwaltung war streng zentralistisch, eine kommunale Autonomie existierte nicht.
Die VOC erließ kurz nach der Koloniegründung ein ausdrückliches Verbot, die indigene Bevölkerung zu versklaven, da sie fürchtete, dass Übergriffe zu Racheakten und teuren Konflikten führen könnten. Die Heren XVII wiesen van Riebeeck an, die Khoisan als Fremde zu behandeln, die nicht der Kapkolonie angehörten und aus der Gesellschaft der niederländischen Siedlung ausgeschlossen bleiben sollten. Vielmehr sollte er ihnen als externen Handelspartnern begegnen, mit denen der Kommandant wie mit einer auswärtigen Macht Verträge abschließen konnte.
Mit der Gründung der Kolonie änderten sich die Beziehungen rasch, neben den bis dahin zentralen Handel trat nun die Konkurrenz um Land. Denn die VOC belegte die Kaphalbinsel mit Beschlag, sodass die lokalen Khoikhoi ihre bisherigen Weidegründe verloren. Seit 1652 nahmen die Europäer dauerhaft Land in Besitz, um es zu bebauen. Dies führte zu Konfrontationen, wobei die Khoikhoi aufgrund ihrer instabilen politischen Strukturen militärische Anfangserfolge, wie etwa bei einem Angriff auf die europäische Siedlung im Jahr 1659, nicht fortsetzen konnten. Allmählich gewannen die Europäer die Oberhand, zumal sie über Feuerwaffen und vor allem eine bessere Organisation verfügten.
Als sich die Niederländer fest eingerichtet hatten, nahm die Zahl der Schiffe zu, die in der Tafelbucht Halt machten, und damit wuchs auch die Nachfrage nach Fleisch. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die Khoikhoi immer schneller ihre Herden verloren, die sie gegen Verbrauchsgüter, wie Tabak, Kleidung oder Metallgegenstände, eintauschten. Zwar gaben die Khoikhoi ihre Rinder nur zögerlich her, weil ihnen bewusst war, dass die Gegengaben der Weißen keineswegs adäquat waren, doch spielten die Niederländer verschiedene Khoikhoi-Gruppen gegeneinander aus und lockten Herdenbesitzer aus dem Landesinneren an die Küste, um dort Handel zu treiben. Die in Küstennähe lebenden Khoikhoi waren nämlich ob des rapiden Rückgangs ihrer Herden alarmiert und gingen europäischen Händlern aus dem Weg. Doch ihre Chiefs wurden nun immer stärker unter die Kontrolle der Kompanie gebracht, was sich in der zeremoniellen Verleihung von Amtsstäben durch den Gouverneur manifestierte. Zudem reagierte Jan van Riebeeck auf die fortgesetzten Diebstähle der Khoikhoi, die freilich andere Eigentumsvorstellungen hatten als die Europäer, indem er Chiefs als Geiseln nahm, um die gestohlenen Güter zurückzuerhalten. Auf diese Weise verschlechterten sich allmählich die Beziehungen und wurden von nachhaltigem Misstrauen gefärbt.
Die VOC begründete ihren Anspruch auf die Kapkolonie mit dem Recht des Eroberers, wodurch die Khoikhoi das Land verloren hätten. Tatsächlich war es ein Prozess gradueller Ausbreitung der Kolonie und der Verdrängung und Unterwerfung der Khoikhoi. In dessen Verlauf kam es zu erstaunlich wenigen kriegerischen Konfrontationen mit den Khoisan, was deren militärische Schwäche belegt, die ihnen offenkundig nur zu bewusst war. So wurden die Khoisan im Lauf der Jahrzehnte immer stärker in die Kolonialgesellschaft hineingezwungen, jedoch ohne ihre rechtliche Stellung formal zu ändern. Bezeichnenderweise äußerte sich die VOC in der Folgezeit dazu gar nicht, was den Schluss zulässt, dass sie die Angleichung der Khoisan an die Position von Sklaven akzeptierte, ohne diesen Schritt rechtlich abzusegnen. Man hielt aus nicht mehr zu rekonstruierenden Gründen lieber an einer Fiktion fest und schuf eine juristische Grauzone.
Als Simon van der Stel 1679 das Kommando über die Kolonie übernahm, gingen die Angriffe vermehrt von den Niederländern aus, die mit verschiedenen Strafaktionen auf tatsächliche oder vermeintliche Übergriffe der Khoikhoi reagierten. Weil die Khoikhoi politisch keine Einheit bildeten, hatten die Niederländer selten Probleme, Verbündete unter ihnen zu finden. Einzelne Chiefs, wie Dorha von den Chainouqua, profitierten davon, weil sie als Mittelsmänner den Viehhandel mit dem Landesinneren organisierten, was der VOC sehr zupass kam.
Im Hinterland pflegte die VOC einen administrativen Minimalismus, indem sie die Zahl der Distrikte so klein wie nur irgend möglich hielt. Darum umfassten sie riesige Territorien, die mit einer Handvoll Personen verwaltet werden mussten. Der höchstrangige Amtsträger in den Distrikten war der Landdrost, ein von Kapstadt ausgesandter Beamter der VOC. Ihm oblagen die Verwaltung, die Rechtsprechung sowie das Oberkommando über die Siedlermiliz und die gelegentlich vorhandenen regulären Truppen. Letztere waren gegen Ende des 18. Jahrhunderts meist farbige Soldaten, die sogenannten Kappanduren, die in Kapstadt stationiert und bei den Weißen besonders verhasst waren, weil sie die Bewaffnung von Nicht-Weißen generell ablehnten. Die zahlreichen Zuständigkeiten des Landdrosts setzten sich bei den ihm untergeordneten Veldkornets fort, die die Unterbezirke verwalteten. Im Gegensatz zum Landdrost wurden sie aus den Reihen der lokalen Notablen gewählt und vom Politischen Rat anschließend ernannt. Diese Universalämter legen beredtes Zeugnis von der marginalen Verwaltung und dem Sparzwang der Kolonialregierung ab. Dem Landdrost stand ein repräsentatives Amts- und Residenzgebäude zu, um das herum sich im Lauf der Jahrzehnte ein kleiner Weiler bildete, mit einer Kirche, einer Schule und kleinen Läden und Handwerksbetrieben. Doch blieben diese Siedlungen winzig und auf die Kolonie bezogen Ausnahmen. Denn der überwiegende Teil der Kolonie war von der Siedlungsstruktur der weit verstreuten Einzelfarmen geprägt, während sich Dörfer oder kleinstädtische Zentren erst im 19. Jahrhundert entwickeln sollten.
Читать дальше