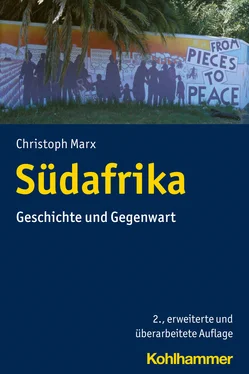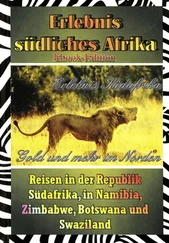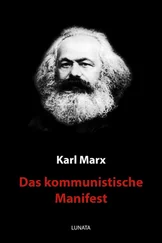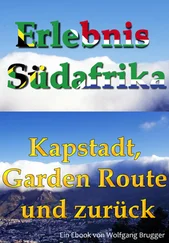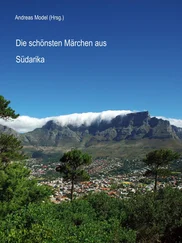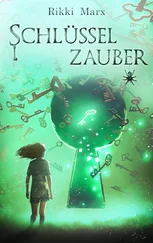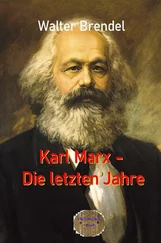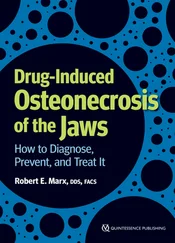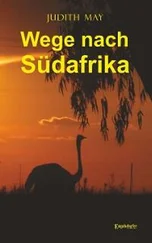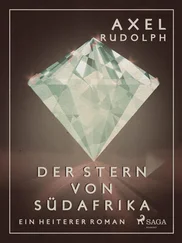1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Weil die Region um Kapstadt zugleich die wohlhabendste war und die Meinungsführer der weißen Bevölkerung dort lebten, entwickelten die dortigen Verhältnisse eine normative Kraft, die weit ins Hinterland ausstrahlte. Obwohl die Mehrzahl der Sklaven im Westen der Kolonie blieb und die indigene Bevölkerung nicht versklavt wurde, wirkten die unfreien Arbeitsverhältnisse wie ein Pilz, der sich in die gesamte Gesellschaft hineinfraß. Tatsächlich glichen sich die Arbeitsverhältnisse für Sklaven und Khoikhoi ungeachtet der Tatsache, dass letztere formal frei blieben, einander immer mehr an. Insofern kann man von einer faktischen Sklaverei sprechen, denn mit Hilfe zunächst lokaler Passgesetze und anderer Formen rechtlicher Ungleichheit wurde ihre Freiheit drastisch beschränkt. Gerade im Westen der Kolonie, im unmittelbaren Hinterland Kapstadts, entstanden die eindeutigsten Hierarchien zwischen Freien und Unfreien im Kontext der Landwirtschaft. Eine Stereotypisierung nach Herkunft schuf bereits die Grundlage für den späteren Rassismus, da man Sklavengruppen bestimmte Eigenschaften zuschrieb und über die Dichotomien von frei – unfrei, Landbesitzer – Landloser, Christ – Heide den Rassismus präformierte, zu dem im Lauf des späten 18. Jahrhunderts dann der Gegensatz von hell-dunkel trat.
Die Folgen der Sklavenhaltung sind bis in die Gegenwart spürbar, denn die Sklavenhalter übten ein Züchtigungsrecht aus, das sie alsbald als ein generelles Recht gegenüber Untergebenen auf ihren Farmen beanspruchten. Die häufige Anwendung von Körperstrafen und eine brutale Strafjustiz der VOC gegenüber Sklaven förderten die Entstehung einer Gewaltkultur. Die ausufernde Gewalt im gegenwärtigen Südafrika ist nicht nur ein Erbe der jüngeren Apartheid-Vergangenheit, sondern hat ihre Wurzeln in der tiefen sozialen Kluft zwischen Freien und Unfreien. Auch der Umgang der weißen Behörden im 20. Jahrhundert mit der schwarzen Bevölkerungsmehrheit, die als Problem und nicht als Bürger behandelt wurde, dürfte seine Ursprünge in einer Gesellschaft haben, in der die Sklaven wie Ware verkauft werden konnten, in der die Buschleute wie Tiere gejagt und getötet wurden und in der unfreie Arbeitsverhältnisse auf immer weitere soziale Kreise und immer größere Räume ausgedehnt wurden.
2.3 Vom Gemüsegarten zur Flächenkolonie
Der Kolonialstaat der VOC war ein ausgesprochen schwacher Staat, dessen Handlungsfähigkeit mit zunehmender Entfernung von Kapstadt schnell abnahm. Die gesellschaftliche Ordnung, die sich im Hinterland entwickelte, war im Wesentlichen das Resultat der von den Farmern dominierten sozialen Prozesse. Aber nicht nur die staatlichen Strukturen waren rudimentär, sondern auch die Wirtschaft, insbesondere im Landesinneren, wo sich eine fast ausschließliche Subsistenzwirtschaft entwickelte, die für die kommerzielle Handelsorganisation VOC denkbar uninteressant war. Darum unternahm sie nur halbherzige Anstrengungen, eine geregelte und effiziente Verwaltung einzuführen. Die Siedler waren weitgehend sich selbst überlassen, im Landesinneren herrschte trotz der lokalen Gerichtsbarkeit des Landdrosts das Recht der Stärkeren, und das waren aufgrund ihres Zugangs zu Feuerwaffen die weißen Siedler – bis sie im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts im Osten auf die bantusprachigen Afrikaner trafen.
Die ursprünglichen Freibürger waren ehemalige Angestellte der VOC, sodass sich deren personelle Zusammensetzung in der Siedlerschaft spiegelte. Für die Kompanie war es schwierig, in den Niederlanden, dem wohlhabendsten Land Europas, Personal für ihre Schiffe und die Faktoreien Asiens zu finden, weil das Risiko groß war, Opfer von Unfällen oder tropischen Krankheiten zu werden. Darum kamen viele der VOC-Angestellten aus dem nach dem 30-jährigen Krieg weitgehend verarmten und zerstörten Heiligen Römischen Reich, aber auch aus Schweden und anderen skandinavischen Ländern. Die Zahl der Angestellten in der Kapkolonie stieg von 120 im Jahr 1660 auf 545 rund vierzig Jahre später an, während am Ende der VOC-Herrschaft 1795 ca. 2000 Männer für die VOC zumeist in Kapstadt arbeiteten. Wie in allen Niederlassungen der VOC waren Soldaten die größte einzelne, gleichzeitig die am wenigsten angesehene und am schlechtesten bezahlte Gruppe. Sie stellten im Durchschnitt die Hälfte der Gesamtzahl der VOC-Bediensteten, doch im 18. Jahrhundert wuchs ihr Anteil auf bis zu 70 %, während die Angestellten, die in der unmittelbaren Verwaltung der VOC tätig waren, nur 10 % ausmachten, dazu mit absteigender Tendenz; Handwerker, Gärtner und Hirten, die für die VOC arbeiteten, stellten den Rest.
Die 200 französischen Hugenotten, die um 1687/88 eintrafen, stellten die einzige organisierte Einwanderung dar. Sie wurden in der näheren Umgebung von Kapstadt angesiedelt, wo sie sich meist dem ihnen vertrauten Weinbau widmeten. Noch heute befinden sich in Franschhoek (wörtl.: Französisches Eck), Stellenbosch und Umgebung die stattlichen Weingüter, Familienstammsitze mittlerweile in ganz Südafrika verbreiteter hugenottischer Familien wie den Marais, de Villiers oder Malan. Allerdings verstreute die VOC die französischen Einwanderer unter ihre niederländischsprachigen Nachbarn, sodass die französische Sprache nach nur einer Generation verschwand. Vor allem Kommandant Simon van der Stel legte großen Wert auf eine schnelle Assimilation der Franzosen, wozu ihn möglicherweise Zweifel an der Loyalität der neuen Siedler motivierten, denn Frankreich befand sich seit 1689 im Kriegszustand mit den Niederlanden.
Auch wenn die Zahl der Hugenotten nicht sehr groß war, so war ihre Einwanderung angesichts der insgesamt noch kleinen Zahl der Siedler, die 1660 gerade 105 Personen gezählt hatten, doch bedeutsam. Immerhin nahm deren Zahl (Männer, Frauen und Kinder) bis 1700 auf 1334 Personen zu und wuchs im Verlauf des 18. Jahrhunderts, als die Neueinwanderung weitgehend ausblieb, durch natürliche Vermehrung auf das mehr als zehnfache, nämlich etwa 15 000 Menschen an.
Die Kolonie blieb in den ersten Jahren auf die unmittelbare Umgebung des Tafelbergs beschränkt, denn erst 1679 gründete Kommandant Simon van der Stel die zweite Ortschaft: das nach ihm benannte Stellenbosch. Es lag etwa 40 km weiter östlich, denn dazwischen erstreckten sich die unfruchtbaren sandigen Ebenen der Cape Flats. Der Distrikt von Stellenbosch zählte 1706 nur 464 Freibürger und das benachbarte Drakenstein (heute Paarl) hatte 524. Die Handelsmonopole der VOC und die folglich fehlenden Marktanreize für die Siedler beschleunigten deren Ausbreitung ins Hinterland. 1743 gründete Gouverneur Swellengrebel an der Südküste den Distrikt Swellendam. Hier lebten im Jahr 1748 ganze 551 Freibürger und am Ende der VOC-Herrschaft 2247 – ein deutlicher Hinweis, wie dünn die Besiedlung war. Schließlich entstand kurz vor der Eroberung durch die Briten im Jahr 1795 mit Graaff-Reinet im Osten der Kolonie der flächenmäßig weitaus größte Distrikt, der zu der Zeit bereits mehr als 3000 (freie) Einwohner zählte.
Wegen des Monopols der VOC und der kaum vorhandenen Infrastruktur lohnte es sich nur in der unmittelbaren Umgebung Kapstadts, für den Absatzmarkt der Handelsflotten zu produzieren. Die weißen Farmer bauten das an, was Europäer meist mit sich führten, wenn sie sich in neue Welten aufmachten: Weizen und Wein, Produkte, die für Christen von zentraler Bedeutung waren. Nördlich und östlich von Kapstadt wurde auf den dafür gut geeigneten Böden Weizen angebaut, wobei dessen Produktionsgebiete sich auf die Klimazone des Winterregengebietes beschränkten. Vor dem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Gebirge bei Stellenbosch und Drakenstein wurde dagegen Wein kultiviert; dem Weinanbau kam das Mittelmeerklima der Kapregion zugute. In diesen Regionen wurden die meisten Sklaven eingesetzt, sodass sich die intensive landwirtschaftliche Produktion mit einer strengen Hierarchie verknüpfte.
Читать дальше