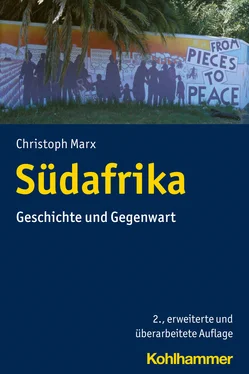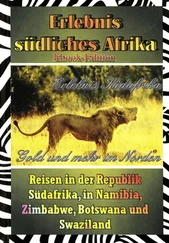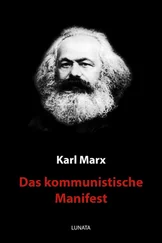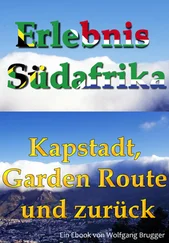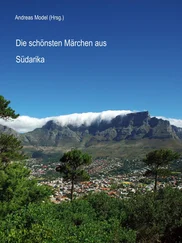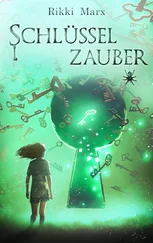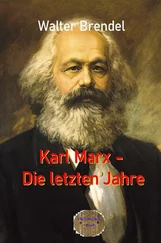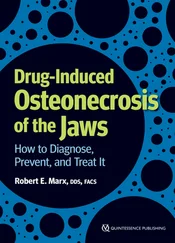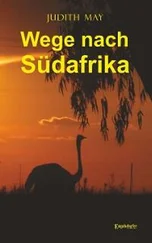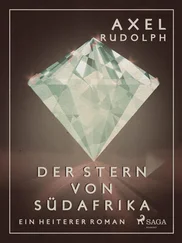Die wenigen übriggebliebenen Khoikhoi-Gruppen zogen sich in gebirgige Regionen etwa das Bokkeveld und Roggeveld nördlich von Kapstadt zurück. Diese Khoikhoi führten Angriffe auf weiße Farmer und Viehdiebstähle aus, für die in den Quellen Buschleute verantwortlich gemacht wurden, wobei jedoch darauf hinzuweisen ist, dass zwischen Khoikhoi und Buschleuten ohnehin keine scharfe Grenze gezogen werden kann. Die Beamten der Kompanie im Landesinneren reagierten auf die Bedrohung mit der Einberufung von Siedlermilizen, die gegen die Khoisan militärisch vorgingen. 1739 unternahm ein Kommando eine besonders gewalttätige Strafexpedition, die ein anderes nach 1770 nochmals steigerte. Diese Aktionen nahmen exterminatorische Formen an, als über 500 und bei späteren Angriffen mehr als 2000 Khoisan ermordet wurden. Der Nebeneffekt der Strafexpeditionen, nämlich die Entführung von Kindern, die als »Lehrlinge« auf den Farmen arbeiten mussten, entwickelte sich oft zum Hauptzweck dieser Expeditionen. Das »Einbuchen« von »Lehrlingen« war der Euphemismus, mit dem eine faktische Sklaverei bemäntelt wurde, die sich in der von der VOC geschaffenen rechtlichen Grauzone bewegte. Noch bis weit ins 19. Jahrhundert erhielt sich dieses System in ganz Südafrika und zahlreiche Kriege und Raubzüge wurden geführt, um in den Besitz von Rindern und Kindern zu gelangen. In ähnlicher Weise wurden die Kinder von männlichen Sklaven und Khoikhoifrauen, obwohl sie dem Status der freien Mutter folgend rechtlich frei waren, auf Dauer festgehalten. Die Farmer argumentierten, sie hätten sie ernährt und darum Anspruch auf ihre Arbeitsleistungen. Meist blieb den Eltern nichts anderes übrig, als sich in ihr Schicksal zu fügen und bei ihren Kindern zu bleiben. Bis zum Ende der VOC-Herrschaft waren fast alle unabhängigen Khoikhoi unterworfen, ihre politischen Strukturen zerschlagen, ihre Gemeinschaften teilweise oder zur Gänze zerstört worden. So stellte der britische Forschungsreisende John Barrow fest, als er 1797 und 1798 den Osten der Kolonie besuchte:
»In dem ganzen großen Districte Graaffreynet ist nicht eine einzige Horde freyer Hottentotten, und vielleicht nicht zwanzig Einzelne, die außer dem Dienste der Holländer leben. Dieses schwache, hülflose Volk, welches jetzt vielleicht das unglücklichste auf der Welt ist, hat nach dem Verluste seines Landes und seiner Freyheit eine Existenz erhalten, welche der Sklaverey wenig nachsteht.« 1 1 Johann Barrows Reisen durch die inneren Gegenden des südlichen Africa in den Jahren 1797 und 1798, Weimar 1801, S. 139 f.
1 »In dem ganzen großen Districte Graaffreynet ist nicht eine einzige Horde freyer Hottentotten, und vielleicht nicht zwanzig Einzelne, die außer dem Dienste der Holländer leben. Dieses schwache, hülflose Volk, welches jetzt vielleicht das unglücklichste auf der Welt ist, hat nach dem Verluste seines Landes und seiner Freyheit eine Existenz erhalten, welche der Sklaverey wenig nachsteht.« 1 1 Johann Barrows Reisen durch die inneren Gegenden des südlichen Africa in den Jahren 1797 und 1798, Weimar 1801, S. 139 f. 1 Johann Barrows Reisen durch die inneren Gegenden des südlichen Africa in den Jahren 1797 und 1798, Weimar 1801, S. 139 f.
Johann Barrows Reisen durch die inneren Gegenden des südlichen Africa in den Jahren 1797 und 1798, Weimar 1801, S. 139 f.
3 Der Zusammenbruch der VOC-Herrschaft und die Konflikte an der Ostgrenze
3.1 Annexion – Rückgabe – erneute Annexion: ein Überblick
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts brach die Welt der VOC zusammen. Die Herrschaft der Kompanie am Kap der guten Hoffnung geriet immer stärker unter Druck, was vor allem Folge ihres schwachen Kolonialstaates war. Während in der östlichen Grenzregion am Ende der VOC-Zeit drei Grenzkriege zwischen den weißen Siedlern und den Xhosa aufflammten, bei denen sich rächte, dass die Regierung in Kapstadt keine Konzepte zur Begrenzung der Siedlerexpansion ausgearbeitet hatte, nahm in Kapstadt und den umliegenden Bezirken die Unzufriedenheit unter der weißen Bevölkerung zu.
Neben die alten Klagen über die leidigen Monopole der VOC traten Beschwerden über Ineffizienz und Korruption der Regierung. Wohlhabende Bürger trafen sich 1778, um ihre Kritik zu artikulieren und entsandten, ungeachtet eines vom Gouverneur ausgesprochenen Verbots, ein Jahr später eine Delegation zur VOC-Führung in die Niederlande. Sie verlangten eine Aufhebung der VOC-Monopole sowie die stärkere Beteiligung der Siedler am Politischen Rat, in dem sie die Hälfte der Sitze forderten. Die VOC-Führung arbeitete, wie immer in solchen Dingen, gemächlich und verschleppte die Angelegenheit bis 1783. Weil die 17 Herren ihre Amtsträger in Kapstadt von den Vorwürfen weitgehend freisprachen, wandten sich die Siedler direkt an die Generalstände. Doch selbst nach einer Überprüfung durch die Generalstände blieb die VOC hart. 1792 entsandte sie die beiden Kommissare Nederburgh und Frykenius ans Kap, die einen rigorosen Sparkurs erzwangen, um die VOC vor dem drohenden finanziellen Kollaps zu bewahren. Damit aber verschärften sie die Polarisierung nur weiter und beschleunigten den rapiden Autoritätszerfall der Regierung.
1787 entmachtete die Patriotenbewegung in den Niederlanden die patrizischen Regenten, woraufhin sich der Statthalter nach Großbritannien ins Exil begab. Kurze Zeit später geriet jedoch die Republik der Niederlande in das Kraftfeld der Französischen Revolution. Seit der Intervention in die Amerikanische Revolution hatte Frankreich sich verstärkt auf den Weltmeeren engagiert und im Flottenbau eine regelrechte Aufholjagd begonnen. Dabei hatten die Franzosen ein starkes Interesse am Kap der guten Hoffnung an den Tag gelegt, da dessen Besitz ihnen die Ausbreitung in den Indischen Ozean erleichtert hätte. Als 1795 die französischen Armeen die Niederlande besetzten, schlugen die Briten präventiv zu, um den Seeweg in ihre mittlerweile wertvollste Besitzung Indien zu sichern und um zu verhindern, dass Frankreich sich als neue Macht im Süden Afrikas etablieren konnte. Nach einer Demonstration der britischen Flottenmacht übergab die VOC ihre Kolonie kampflos an die neuen Herren. Die Patriotenregierung der Niederlande löste 1799 die VOC auf, die sie als Instrument der verhassten Regenten ablehnte.
Die Briten hatten 1795 zwar die Kapkolonie erobert, doch zunächst ohne die Absicht, länger zu bleiben. Die britische Herrschaft dauerte bis 1803, denn schon mit dem Abschluss des Friedens von Amiens am 25. März 1802 war allen Beteiligten klar, dass die Kolonie wieder an die Niederländer zurückfallen würde. Knapp ein Jahr später trat die Batavische Republik, ein mit Unterstützung des revolutionären Frankreichs gebildeter niederländischer Staat, das Erbe der Briten an. Nachdem General Napoleon Bonaparte den Frieden von Amiens u. a. mit den Briten abgeschlossen und damit das Wiedererstehen eines unabhängigen niederländischen Staates ermöglicht hatte, gab Großbritannien die Kolonie zurück. Die Batavische Republik verwandelte sich nach demokratischen Anfängen sukzessive in einen autoritären Staat, dem Napoleon mit der Erhebung seines Bruders Louis zum König im Jahr 1806 ein Ende setzte, was für die Briten Anlass zur erneuten Intervention wurde. Als die Feindseligkeiten zwischen Großbritannien und Frankreich einige Jahre später aufflammten, ergriff eine britische Landungstruppe am 19. Januar 1806 in Kapstadt erneut Besitz von der strategisch außerordentlich wichtigen Kolonie. Diesmal blieben die Briten und die Niederländer mussten ihnen das Gebiet in der Londoner Konvention vom 13. August 1814 abtreten, was im umfassenden Vertragswerk des Wiener Kongresses 1815 völkerrechtlich bestätigt wurde. Diese Vorgänge sind primär aus dem europäischen Kriegsgeschehen zu erklären, denn die Regierung des konservativen britischen Premierministers William Pitt schenkte der Südspitze Afrikas sonst wenig Beachtung. Es genügte ihr, dass sich die Franzosen dort nicht festsetzten.
Читать дальше