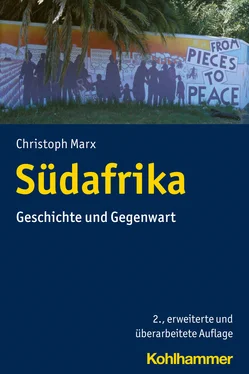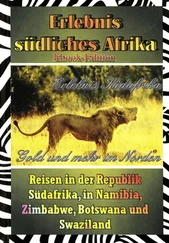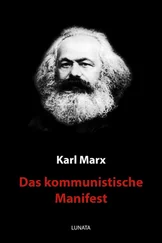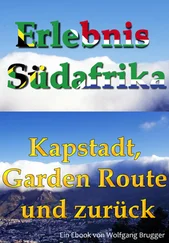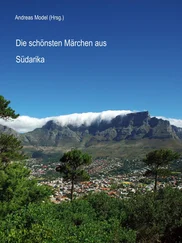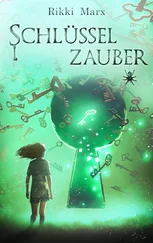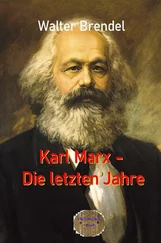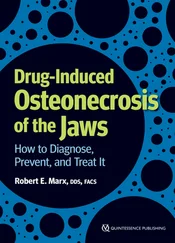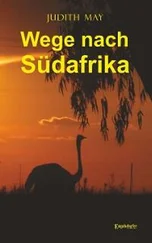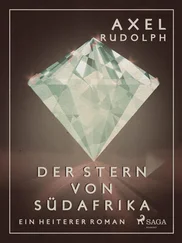Sowohl Gouverneur Janssens als auch Generalkommissar de Mist wollten während ihrer kurzen Herrschaft mit dem ganzen Impetus eines von der Aufklärung inspirierten Neuanfangs eine Bestandsaufnahme der Kolonie machen, weshalb die beiden Batavier ausgedehnte Reisen unternahmen. Ihre Reformprojekte scheiterten am Unverständnis und den gefestigten Interessen der weißen Bewohner. Auch unter den Bataviern wurden die Landdroste aus den Reihen der Staatsangestellten ausgewählt, die Heemraden und Veldkornette dagegen aus der lokalen Bevölkerung. Immerhin konnte wieder eine im Vergleich zur britischen Herrschaft größere Unabhängigkeit der Justiz hergestellt werden, da der Raad van Justisie der Kontrolle des Gouverneurs entzogen wurde. Außerdem wurde eine unabhängige Rekenkamer eingerichtet, die die Finanzen kontrollieren und dadurch die Korruption bekämpfen sollte.
Entsprechend ihrer aufklärerischen Überzeugung engagierten sich de Mist und Janssens besonders im Kirchen- und Erziehungswesen. Der Status der Reformierten Kirche als Staatskirche blieb aufgehoben und andere Denominationen – sogar in eingeschränktem Maß die katholische Kirche – wurden zugelassen, doch mussten sich alle Kirchen selbst finanzieren. Dies lief aber keineswegs auf eine glatte Trennung von Staat und Kirche hinaus, da der Staat sich eine Oberaufsicht über die Kirchen vorbehielt.
Im Erziehungswesen konnte de Mist aus Geldmangel viel weniger erreichen. Seine Schulordnung von 1804 sollte zu einer Verbesserung und Modernisierung des Unterrichts beitragen, doch scheiterten seine Pläne für eine Säkularisierung der Schulen. Diese Schulen waren weitgehend auf Kapstadt beschränkt, denn auf dem Land gab es nur sehr wenige, die Erziehungsarbeit wurde von oft selbst kaum gebildeten Hauslehrern erledigt. So blieb die Zahl der Analphabeten unter den Farmern in den entfernteren Bezirken sehr groß, bei der Khoikhoi- und Sklavenbevölkerung die Norm.
Den Bataviern schwebte den liberalen Vorstellungen ihrer Zeit gemäß ein System des Freihandels vor, weshalb sie alle Privilegien und den merkantilistischen Dirigismus der Kompaniezeit beseitigten wollten. Die Realität sah anders aus, denn die Regierung der Niederlande sah sich gezwungen, aus purer Geldnot sogar die alten Monopole wieder einzuführen, die die Briten abgeschafft hatten: Sie sollten die Staatseinnahmen erhöhen.
Zwischen der batavischen Verwaltung und den weißen Siedlern gab es nur geringe Zwistigkeiten. Ein Teil der Siedler hatte die britische Herrschaft abgelehnt, weniger aus einer antienglischen Haltung heraus als wegen des autokratischen Gehabes der obersten Beamten. Die Batavier befleißigten sich einer egalitären Rhetorik und genossen möglicherweise einen Sympathievorschuss, weil sie Niederländer waren, aber keineswegs beabsichtigten, die lästige und ineffiziente Kompanieverwaltung zu restaurieren. Das Verhältnis zu den Bürgern blieb auch deswegen während der drei Jahre im Wesentlichen ungetrübt, weil es de Mist und Janssens nicht gelang, ihre Reformen wirklich durchzusetzen. So waren beide z. B. entschiedene Gegner der Sklaverei und de Mist untersagte die weitere Zwangszuwanderung von Sklaven. Angesichts der ökonomischen Notwendigkeit blieb es jedoch bei einer papierenen Verordnung. Die noch viel weiterreichenden und selbst für die damaligen revolutionären Zeiten sehr fortschrittlichen Pläne einer Befreiung aller Sklaven der Kolonie ließen sich erst recht nicht realisieren. Selbst der Versuch, schriftliche Arbeitsverträge für die Khoikhoi einzuführen und ihre Behandlung durch die Farmer besser zu kontrollieren, scheiterte bereits am Personalmangel und den riesigen Entfernungen.
Großbritannien und die Batavische Republik erbten von der VOC eine problematische Situation an den Grenzen der Kolonie. Sie war ein Ergebnis des über viele Jahrzehnte gepflegten staatlichen Minimalismus. Die knauserige Regierung der VOC hatte die Expansion der Siedler kaum noch kontrolliert. Zwar hatte sie 1786 im Osten einen neuen Distrikt eingerichtet, mit dem kleinen Weiler Graaff-Reinet als Sitz eines Landdrosts. Doch war diese Verwaltungseinheit viel zu weitläufig, um effizient durch eine Handvoll Amtsträger verwaltet werden zu können. Die ungesicherten und unklaren Grenzen im Norden und Osten führten zu Konflikten, die die VOC nicht mehr beherrschen konnte.
Der »wilde Norden« Südafrikas
Die weiße Oberschicht nutzte den privilegierten Zugang zu Gerichten und zur Verwaltung, um ihre Besitzansprüche auf Land durchzusetzen, sodass andere, die über weniger Einfluss und Ressouren verfügten, in die Randzonen abwandern mussten. Im Verlauf dieses Prozesses waren die unterprivilegierten und ärmeren Mitglieder der Gesellschaft in die äußeren Randgebiete der Kolonie migriert, sodass man von einer abgestuften Form sozialer Hierarchisierung und staatlicher Ordnung sprechen kann, die in Kapstadt und deren unmittelbarer Umgebung am intensivsten war und an der nördlichen Grenze am schwächsten.
Die Menschen, die die geringsten Möglichkeiten hatten, sich in diesem sozialen Ausleseprozess zu behaupten, waren die Khoisan, die lange Zeit in gebirgigen Rückzugsgegenden innerhalb der Kolonie einige Nester von Autonomie und Widerstand hatten erhalten können. Je mehr diese aufgesiedelt wurden, desto stärker wurde der Exodus in Richtung der Kolonialgrenze. Dort entwickelte sich ein Zustand, den man nach dem Vorbild der nordamerikanischen Geschichte als Frontier, d. h. als wandernde Siedlungsgrenze, bezeichnet. Damit sind uneindeutige Situationen in Randgebieten von Siedlergesellschaften gemeint, in denen der Staat zu schwach war, um seinen Ordnungsanspruch durchsetzen zu können. Es war die große Zeit der Frontierdesperados, die in diesem Raum unklarer Verhältnisse ihr Unwesen trieben. Sie gingen zudem auf beiden Seiten der Grenze ständig wechselnde Allianzen ein, mal mit den Bewohnern der Kapkolonie, mal mit afrikanischen Chiefdoms außerhalb von deren Grenzen.
Alle, die in der Kapkolonie keine Chancen mehr sahen, sammelten sich im ariden Norden und in der Flussoase des Oranje, der sich in seinem mittleren und unteren Lauf durch halbwüstenartige Gebiete schlängelt. Es war eine wilde Mischung aus Trekburen, desertierten Soldaten und entlaufenen Matrosen, flüchtigen Sklaven, Nachkommen weißer Farmer und afrikanischer Frauen oder von Sklaven und Khoisan, den sogenannten Bastard-Hottentotten, vor allem aber die Khoisan selbst. Diese waren mittlerweile meist christianisiert, trugen europäische Kleidung und sprachen ein vereinfachtes Niederländisch, den Vorläufer des späteren Afrikaans, kurzum, sie hatten sich kulturell weitgehend der dominierenden Siedlergesellschaft der Kapkolonie angeglichen, wurden von dieser wegen Abkunft und Hautfarbe aber nicht als gleichberechtigt anerkannt. Weil sie über Pferde verfügten und den Nachschub an Waffen und Munition über Kapstadt organisieren konnten, waren sie den afrikanischen Chiefdoms in ihrer Nachbarschaft militärisch überlegen.
Aus den heterogenen Gruppen, die sich nach klientelistischen Strukturen um einzelne Figuren und ihre Familien wie die Kok und Barends bildeten, entstanden neue Gemeinschaften, die sich zur ethnischen Gruppe der Griqua verfestigten und über Jahrzehnte hinweg von diesen auf zentrale Patrone zugeschnittenen Sozialstrukturen geprägt blieben. Da sie durch die lange Phase der Vertreibung und aufgrund der unbekannten ökologischen Verhältnisse der landwirtschaftlichen Tätigkeit entwöhnt waren, verlegten sich viele auf das lukrativere und einträglichere Geschäft des Raubes. Sie verübten Überfälle auf schwarze Chiefdoms, aber auch auf nichtsahnende Nachbarn, denen man ihr bewegliches Eigentum, in erster Linie die Rinder- und Schafherden, wegtrieb. Dadurch wiederum provozierten sie Gegenschläge und Racheaktionen mit dem Ergebnis, dass die ganze Grenzregion von endemischer Unsicherheit geprägt war. Hinzu kamen die Jagd auf Menschen und der Handel mit gefangenen afrikanischen Kindern, die an die weißen Farmer als billige Arbeitskräfte verhökert wurden. Außerdem betrieben die Griqua einen intensiven Handel u. a. mit Elfenbein, wofür sie Artikel des täglichen Bedarfs aus der Kolonie erhielten, wie Tabak, Kleidung, vor allem aber Waffen und Munition.
Читать дальше