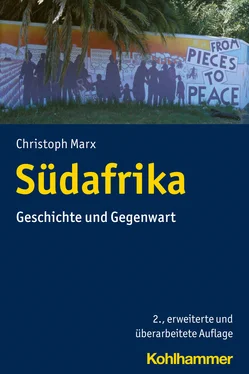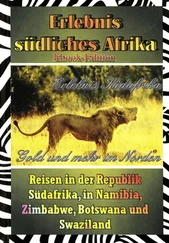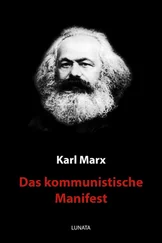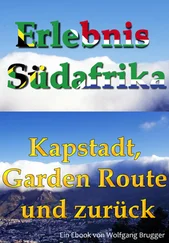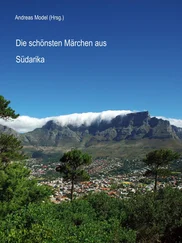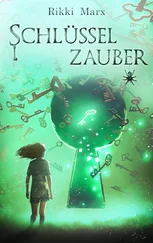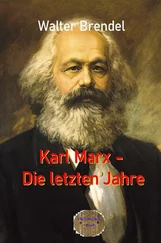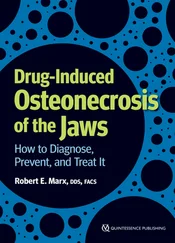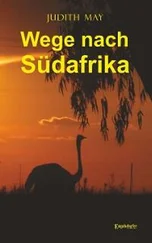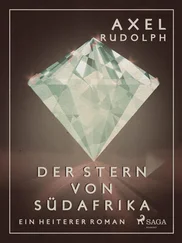Mapungubwe wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts verlassen und vermutlich hat sich der Schwerpunkt dieses Reiches um einige hundert Kilometer nach Nordosten verlagert, wo mit den großen steinernen Anlagen von Great Zimbabwe ein neues Reichszentrum entstand. Die weitere Entwicklung betraf folglich nicht mehr Südafrika, doch ist festzuhalten, dass die vermutete Ursache für die Zentralisierung im Fernhandel lag, denn dies war ein Element, das einzelnen Chiefs neue Machtchancen eröffnete. Den Grund für die politischen Zentralisierungen hat man lange in endogenem ökonomischem Wachstum oder umgekehrt in ökologischen Krisen gesehen, da man den Afrikanern als historisch Handelnden dadurch besser gerecht zu werden glaubte. Doch spricht vieles dafür, dass der Fernhandel die entscheidende Variable war, die den Aufstieg einzelner Chiefs ermöglichte. Die Verbindung von Fernhandel und Zentralisierung lässt sich wiederholt in der südafrikanischen Geschichte feststellen.
Erst 500 Jahre nach Mapungubwe liegen erneut Nachrichten über die vorkolonialen afrikanischen Chiefdoms vor. Portugiesische Schiffbrüchige, deren Segelschiffe in den tückischen Unterströmungen an der südafrikanischen Felsenküste aufgelaufen waren, hielten sich einige Zeit bei der bantusprachigen Bevölkerung der Xhosa auf. Dieses etwa 70 000 bis 100 000 Menschen zählende südlichste Bantuvolk lebte direkt an der Grenze des Sommerregengebiets und bildete offenbar eine weitere Ausnahme von der Regel kleiner Chiefdoms, denn im 16. Jahrhundert entstand ein Xhosa-Königreich, d. h. auch hier hatte ein Prozess politischer Zentralisierung stattgefunden, ohne dass die Gründe dafür bekannt sind. Etwa 200 Jahre später setzte ein Zerfall in kleinere Chiefdoms ein, wobei alle Chiefs Angehörige der Königsfamilie, des Tshawe-Clans, blieben. Die Identität der Xhosa-Bevölkerung bemaß sich nach der politischen Loyalität zu einem der Angehörigen des Tshawe-Clans.
Die dünne Besiedlung sowie die Ausweichmöglichkeiten für unzufriedene Chiefs und ihre Anhänger erklären, warum die wenigen Königreiche, von denen wir wissen, instabil waren und, wie etwa dasjenige der Xhosa, dazu tendierten, sich aufzuspalten. Die zentripetalen Kräfte dagegen, die überhaupt zur Entstehung zentralisierter Formen von Herrschaft führten, sind weniger klar eruierbar. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber spielte der Handel eine ganz entscheidende Rolle, denn überall da, wo sich Zentralisierungen aufgrund archäologischer oder schriftlicher Quellen rekonstruieren lassen, waren die Handelsbeziehungen weitaus intensiver als sonst üblich. Bei den Waren handelte es sich nicht um Lebensmittel und nur in untergeordnetem Maß um Gegenstände des täglichen Bedarfs wie Metallwerkzeuge u. a., sondern um Prestigegüter, die insbesondere den Chiefs zugutekamen. Da es im südlichen Afrika keine spezialisierten Händler wie etwa in Westafrika gab, konnten die Chiefs den Handel weitgehend kontrollieren und monopolisieren. Das Fehlen von Marktbeziehungen zwischen den Chiefdoms ist die Ursache, warum die kleinen Chiefdoms über so lange Zeit der Regelfall blieben. Erst mit einer wachsenden ökonomischen Ungleichheit, mit erhöhten Wettbewerbschancen derjenigen, die Zugang zu knappen und wertvollen Gütern hatten, war die Voraussetzung für großräumigen Herrschaftsausbau gegeben.
1.5 Erste Kontakte mit Europäern
Wie bereits im Zusammenhang mit der Entstehung eines Xhosa-Reiches angedeutet, waren die Portugiesen die ersten Europäer in der Region. Im Jahr 1486 tauchte erstmals ein europäisches Schiff in den Gewässern des südlichen Afrikas auf. Seit dem frühen 15. Jahrhundert hatten sich die Portugiesen entlang der Küste Afrikas in die Weiten des Atlantiks vorgetastet. Nach Überwindung vieler, nicht zuletzt psychologischer, Hürden erreichte der Seefahrer Bartholomeo Dias Ende des 15. Jahrhunderts den Südatlantik. Von einem heftigen Sturm weit nach Süden getrieben, steuerte er sein Schiff nach Osten, um die afrikanische Küste wieder zu erreichen, die er jedoch nicht mehr fand. Ihm wurde klar, dass er über die Südspitze des Kontinents hinausgefahren war, und er wendete sein Schiff in Richtung Norden, wo er östlich der heutigen Stadt Port Elizabeth die afrikanische Südküste erreichte. Erst auf der Rückfahrt erblickte er das Kap, die felsige Südwestspitze des Kontinents, das er aufgrund seiner Erfahrungen »Kap der Stürme« taufte. Nachdem er, nach Portugal zurückgekehrt, seinem Auftraggeber, König Johann II., die frohe Kunde überbracht hatte, benannte dieser es um in »Kap der Guten Hoffnung«, weil den Portugiesen nunmehr der Seeweg nach Indien offenstand. Mit der ersten Fahrt Vasco da Gamas 1498 begann die dauerhafte portugiesische Präsenz im Indischen Ozean und damit ein regelmäßiger Schiffsverkehr um die Südspitze Afrikas. Es war den Portugiesen gelungen, die Seidenstraße, an deren westlichem Ende das immer mächtiger werdende Osmanische Reich den Handel kontrollierte, zu umgehen und die in Europa begehrten Gewürze direkt bei den Erzeugern in Asien einzukaufen. Dies weckte bei anderen Europäern Begehrlichkeiten. Portugal wurde durch die Vereinigung seiner Krone mit derjenigen Spaniens von 1580–1640 in die Auseinandersetzungen der Habsburger mit ihren europäischen Rivalen und Feinden hineingezogen. Diese richteten ihre Angriffe, die die spanischen Habsburger und ihr überseeisches, ressourcenstarkes Reich treffen sollten, seit dem Ende des 16. Jahrhunderts vermehrt auch gegen Portugal. Erste Erkundungsfahrten der Niederländer und Engländer zeigten, dass es für sie nur dann im Indischen Ozean Betätigungsfelder geben konnte, wenn die Aktivitäten der verschiedenen Interessengruppen und Kaufleute koordiniert wurden, da Portugal sich mit bewaffneter Macht gegen das Eindringen anderer Europäer zur Wehr setzte.
In beiden protestantischen Ländern sorgten die Machteliten dafür, dass die Kaufleute sich in Monopolgesellschaften zusammenschlossen, um einerseits die Preise für ihre Waren stabilisieren und manipulieren zu können und um andererseits die Ressourcen zu bündeln. Denn die Fahrten in den Indischen Ozean konnten nur von gut bewaffneten Flottenverbänden unternommen werden. Im Jahr 1600 gründete Elisabeth I. durch einen Erlass die englische East India Company und zwei Jahre später bildete sich in den Niederlanden die Vereinigte Ostindische Kompanie (VOC). Aufgrund ihrer weitaus stärkeren Kapitalausstattung konnte sich die VOC in Südostasien festsetzen. Es gelang ihr, den Zugang zu den Molukken, den Banda-Inseln und Ceylon (Sri Lanka), wo Nelken, Muskat und Zimt angebaut wurden, zu monopolisieren und sich lukrative Gebiete in Südindien und auf Sumatra zu sichern, wo Pfeffer produziert wurde. Verwaltet wurde das weitgespannte seegestützte Reich der Niederländer, das aus einem Netzwerk von Handelsstationen bestand, durch eine Zentrale auf der Insel Java. Diese Stadt nannte die VOC nach den Batavern, einem von den Römern erwähnten, im Rheinmündungsgebiet ansässigen Germanenstamm, den man für die unmittelbaren Vorfahren der Niederländer hielt, Batavia, das heutige Jakarta.
Für viele Ostindiensegler, zu denen später noch die Franzosen und gelegentlich Skandinavier hinzukamen, war die Südwestecke Afrikas eine beliebte Anlaufstation, da man dort frisches Wasser aufnehmen und den Khoikhoi Schlachtvieh abkaufen konnte. Im Gegenzug erhielten diese von den Europäern Kupfer und Eisen, Metalle, die sie bis dahin nur in unzureichendem Maß bei den Völkern des Landesinnern erwerben konnten, sowie Tabak, der sich rasch unter ihnen ausbreitete, da sie bis dahin hauptsächlich eine lokale Art des Marihuanas, Dagga (ausgesprochen: dacha), gekannt hatten. Diese Kontakte verliefen nicht immer friedlich, sondern es kam schon bei den ersten Landgängen der Portugiesen gelegentlich zu gewalttätigen Konfrontationen.
Im frühen 17. Jahrhundert häuften sich die europäischen Schiffe, die vor allem in der dafür besonders gut geeigneten Bucht ankerten, die unterhalb des schon von weitem sichtbaren Tafelberges lag. Die Idee, dort eine dauerhafte Lebensmittelstation zu gründen, hatte mit der Vitaminmangelkrankheit Skorbut zu tun, die zahlreiche Todesopfer unter den Schiffsbesatzungen forderte, sodass viele Seeleute längere Zeit auf dem südafrikanischen Festland zur Erholung zubringen mussten, bevor sie in der Lage waren, ihre gefährliche Fahrt fortzusetzen.
Читать дальше