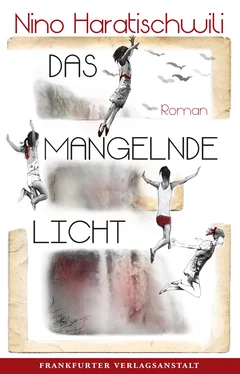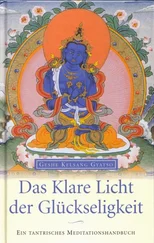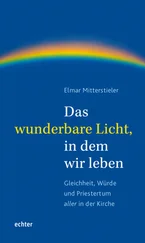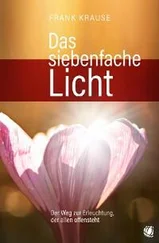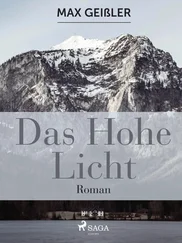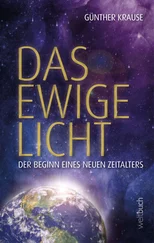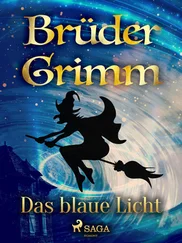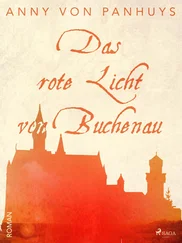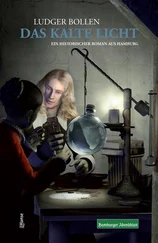Ich aber wollte nichts erklären müssen, schon gar nicht der Außenwelt. Meine Erinnerungen, die mich an Dinas Fotografien ketten, sind gewiss ganz anders als die Hintergründe, die die Kunstwelt hineininterpretiert – nie im Leben käme ich auf die Idee, sie mit Fremden zu teilen. Nun bin ich Teil ihrer Kunst, genauso wie Ira und Nene es sind. Meine Abwehr hat durchaus egoistische, selbstschützende Motive, andererseits käme es einem Verbrechen gleich, ihrer Kunst durch meine Äußerungen in irgendeiner Weise zu schaden. Ich, die ich selbst in meinem Leben im Dienst fremder Bilder stehe, sollte dies nur zu gut wissen.
Ira ist in ein angeregtes Gespräch mit Anano vertieft. Mein Blick schweift umher, und ich werde auf eine andere Aufnahme aufmerksam, schlafwandlerisch, wie von einem Sirenengesang angelockt, bewege ich mich auf dieses Foto zu, das ich nicht kenne, das ich zum ersten Mal sehe, ich will wissen, aus welcher Schaffensperiode es stammt, denn eigentlich kenne ich sie alle, weiß bei fast jedem Foto das Wann und Wo, welche Stimmung herrschte, um welches Ereignis es sich handelt, welche Kränkung und welche Freude sich dahinter verbergen. Doch diese Aufnahme sagt mir nichts, ich erkenne aber alles darauf wieder, alles ist so vertraut, es ist, als würde ich in einen Brennnesselbusch fallen und meine Haut steht in Flammen.
Es ist eine Aufnahme unseres Hofs, unsere Wohnungen sind aus der Vogelperspektive zu erkennen, durch die Distanz und Höhe erscheinen sie so winzig mit der flatternden Wäsche, dem kleinen Garten mit dem ewig tropfenden Wasserhahn, der Wippe, dem Granatapfel- und dem Maulbeerbaum. Sie muss aufs Dach geklettert sein, um das Foto zu schießen. Wieder hatte sie keine Hindernisse gescheut und einen Weg gefunden, diesen so vertrauten Ort aus einem vollkommen neuen Blickwinkel zu erkunden.
*Begriffserklärungen siehe im Glossar.
Der Hof war das Universum unserer Kindertage und lag im hügeligsten und buntesten Viertel aller Tbilisser Stadtteile. »Das Sololaki-Viertel verdankt man den wasserreichen Quellen der umliegenden Berge, durch die sich dieser einst verwinkelte Ort im Laufe der Jahrhunderte zu jenem so begehrten und in buntem Mischmasch aufblühenden Viertel entwickelt hat.« Ich betrachte das Foto und höre die Stimme meines Vaters zu mir sprechen, der mir so oft und viel über unser Viertel erzählte, als ich noch an seiner Hand durch die engen Gassen unseres Stadtteils lief. »Unter der arabischen Herrschaft benötigte man viel Wasser, um die Festungsgärten zu gießen, und so ließ man einen Kanal anlegen, der es von den Sololaki-Hügeln ins Tal hinunterleitete. Als später die Türken die Herrschaft übernahmen, machten auch sie Gebrauch von jenem Wasser. Auf Türkisch heißt Wasser su , und so wanderte dieses türkische Wort in die georgische Bezeichnung des Stadtteils ein, und aus dem U wurde ein O. Im neunzehnten Jahrhundert ließen sich viele reiche Georgier in dieser Gegend nieder und legten hier ihre Gärten an, und auch dabei kam dem Wasser eine entscheidende Rolle zu. So wuchs das Sololaki-Viertel zu einem angesehenen Stadtteil, und viele graziöse Villen mit Buntglasfenstern und pittoresken Holzbalkonen schmückten alsbald die kopfsteingepflasterten Straßen.«
Als ich auf die Welt kam und in die schattige und stets feuchte Wohnung in der Rebengasse 12 gebracht wurde, die zwischen der langen Engelsstraße und dem Toneti-Platz lag, wohnten die ranghohen KP-Funktionäre bereits in anderen Vierteln, und die einst prachtvollen Sololaki-Villen waren vom Staat umfunktioniert worden. Die Bewohner lebten nun in den sogenannten Tbilisser Höfen. Wieder höre ich die monotone, beruhigende Stimme meines Vaters in meinem Kopf: »Da wegen der allgemeinen Wohnungsknappheit viele Familien in diesen Höfen hausten und sich das Leben immer mehr nach draußen verlagerte, ging es hier sehr laut zu. Und weil es die Zeit der italienischen neorealistischen Filme war, brachte man diesen Lärm schnell mit Italien in Verbindung. So wurden aus den Tbilisser Höfen die Italienischen Höfe.«
Ich sehe diese Höfe vor mir, ich wandere durch die kopfsteingepflasterten Straßen und biege in die Rebengasse ein, wo mein Leben seinen Anfang nahm. Dieses Viertel ersetzte mir damals die ganze Welt. Hier laufe ich in meiner Vorstellung umher, entlang dem Botanischen Garten, der Kreuzvater-Kirche und der Engelsstraße, in der unsere Schule lag, zu den oberen Hängen des Mtazminda mit der Zahnradbahn, zum Fernsehturm und zum Vergnügungspark, zu den Hügeln nach Okrokana, durch die vielen verwunschenen Gassen und Holztreppen inmitten von Reben, die die Balkone überwucherten, und die kleinen verwinkelten Straßen, über den imposanten Leninplatz zum Rathaus, zwischen lästigen Tratschtanten und den ewig ihre KAMAZ-Autos waschenden Männern, zwischen flatternder Wäsche und kleinen Brunnen – an diesen Orten fanden all meine Tragödien und Komödien statt, dort tastete ich mich ins Leben hinein, dort erlebte ich auch den Zusammenbruch einer Welt, ungläubig, mit weit aufgerissenen Augen und mit Todesangst in den Lungen.
Ich sehe unseren viereckigen Hof vor mir. Die zwei gegenüberliegenden Häuser, dazwischen ein winziger umzäunter Garten, dazu rechter Hand das kleine zweistöckige Steinhäuschen auf Stelzen, das später dazugebaut wurde und, weniger bunt und schön, wie auf Hühnerbeinen etwas verloren herumstand, als wäre es einem russischen Märchen entsprungen.
Anders als bei den tschechoslowakischen oder österreichischen Pawlatschenhäusern hatte man bei uns nicht nur über die Straße und das Treppenhaus mit seinen schiefen Holztreppen Zugang zu den Wohnungen, sondern auch vom Hof aus über die krummen Holzstiegen und Wendeltreppen. Die einzelnen Wohnparteien waren durch einen hölzernen Laubengang miteinander verbunden. Während unser Haus dreistöckig und mit den schnörkeligsten Laubengängen versehen war, war das gegenüberliegende Backsteinhaus erst um die Jahrhundertwende gebaut worden und der solideste Bau des Hofes, mit Efeu bewachsen, zweistöckig, davor Metallbalkone mit blumigen Verzierungen.
Das eigentliche Leben der drei Hausgemeinschaften fand entweder in den Laubengängen oder im Hof statt. Dort wurde Backgammon oder Domino gespielt, dort wurden Rezepte ausgetauscht, dort lagerten die Einmachgläser der Hausfrauen und das abgelegte Spielzeug der Kinder, dort wurden Kräuter gegen Mehl getauscht, Krankheiten besprochen und Ehekrisen ausgetragen, dort wurden Liebschaften entlarvt. Fast alle der hölzernen Wohnungstüren hatten Glasfenster, so dass allen Hofbewohnern klar war, dass jegliche Abschirmung von vornherein eine Illusion darstellte. Es gab immer einen an Schlafstörungen leidenden Nachbarn, der jedes Kommen und Gehen, unabhängig von der Uhrzeit, registrierte, dem jeder Streit zu Ohren kam und der jede leidenschaftliche Versöhnung zu kommentieren wusste. Der Hof war ein Organismus, in dem die einzelnen Wohnparteien die Organe bildeten, alle miteinander verbunden, alle notwendig, um den Körper am Laufen zu halten. Erst später kam mir der Verdacht, dass die Kommunisten bei der Wohnungsverteilung ihr Augenmerk darauf richteten, in diesem Mikrokosmos viele verschiedene Berufsgruppen anzusiedeln, die sich gegenseitig aushelfen konnten, damit dem Staat möglichst wenig Belästigung und Aufwand entstand: Wurde einer krank, wurde er hofintern versorgt, brauchte jemand Strümpfe, die nur unter dem Ladentisch verkauft wurden, regelte man auch das untereinander, wollte sich jemand gute Noten kaufen, um an der Universität studieren zu können, wurde das nachbarschaftlich geklärt. Der Hof war ein Staat im Staat. Ein auf den ersten Blick vorbildlich sozialistischer: Alle waren gleich, mit denselben Rechten ausgestattet, unabhängig von Ethnie und Geschlecht, aber natürlich war auch das nur eine Scheinrealität. Im Grunde hatte jeder seinen Platz in diesem Konstrukt, und jeder wusste über seine Privilegien Bescheid. Und so würde der armenische Schuster Artjom nicht einmal im Traum darauf kommen, seine Fühler nach einer Georgierin aus einer Akademikerfamilie auszustrecken, genauso wenig würde die Fabrikantenfamilie Tatischwili die kurdische Familie von rechts gegenüber zu sich einladen.
Читать дальше