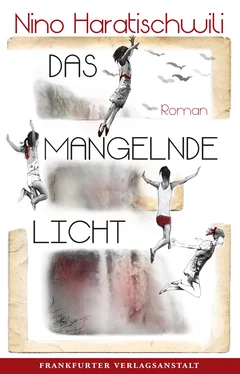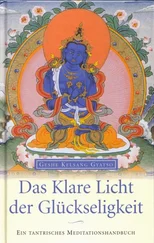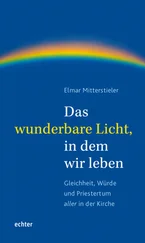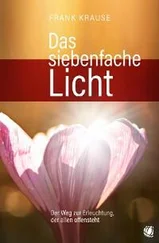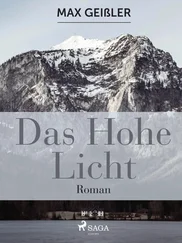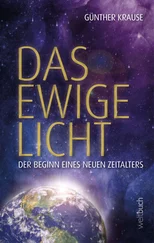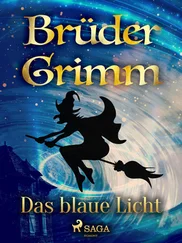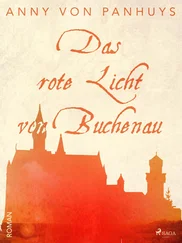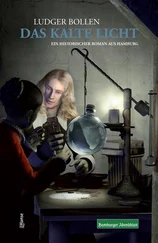Sogar wir, die Kinder des Hofes der Rebengasse 12, hatten diese ungeschriebenen Gesetze verinnerlicht, ohne uns selbst dessen bewusst zu sein. Wir ahmten einfach die Erwachsenen nach, wobei die Tatsache, dass wir den kurdischen Tarik beim Verstecken und bei Himmel-und-Hölle mitspielen ließen, obwohl uns eingetrichtert wurde, dass er schmuddelig war, eine Lernschwäche hatte, seinen Schnodder aß und weggeworfene Kaugummis kaute, einzig und allein darin begründet lag, dass es sich gut anfühlte, jemanden wie ihn in unserer Nähe zu dulden. Denn auch das war eine Eigenheit unseres Hofes, unseres Viertels, ja, vielleicht unserer Stadt: Wir wollten immer um jeden Preis gemocht oder geliebt werden, und wir wussten, dass es sich gut machte, einen Schwächeren zu beschützen, in dieser Mehrvölkerstadt, die seit Jahrhunderten mit den anderen koexistierte. Schließlich waren wir doch die besten Gastgeber und die tolerantesten Nachbarn, wir krümmten niemandem ein Haar und luden alle zu uns ein, wir bewirteten sie und lachten ihnen ins Gesicht, aber wenn sie wieder gingen, atmeten wir erleichtert auf und rümpften die Nase über ihre Tischmanieren oder ihre derbe Art. Die anderen waren immer ein wenig schlechter und ein wenig gröber, ein wenig dümmer und ein wenig benachteiligter als wir.
Unsere Wohnung war meiner Großmutter väterlicherseits, die wir »Babuda eins« nannten, nach der Rehabilitierung ihrer Familie überlassen worden. Sie hatte hohe Decken und feuchte Wände, schnörkelige Balkone zur Straßenseite und tropfende Wasserhähne, gegen die jeder Handwerker machtlos war. Hier wuchs mein Vater auf, dorthin brachte er meine Mutter, nachdem sie Moskau den Rücken gekehrt hatten. Dorthin brachte man auch meinen Bruder und fünf Jahre später mich, nachdem wir in einem kahlen Kreißsaal irgendwo in Bahnhofsnähe das Licht der Welt erblickt hatten. In meinem Zimmer – mein winziges improvisiertes Reich – hingen lauter Poster aus teuer auf dem Schwarzmarkt ergatterten »Ausländischer-Film«-Magazinen. Als Kinder hatten mein Bruder und ich das schöne, etwas größere Zimmer geteilt und nicht selten Kissenschlachten und Mutproben veranstaltet, aber mit den Jahren wurde es zu eng für uns beide, und so wurde ich in die winzige Kammer neben der Küche – einst Vorratskammer – verfrachtet. Ich mochte sie nicht sonderlich gern, aber immerhin hatte ich es besser als Babuda eins und (folgerichtig meine Großmutter mütterlicherseits) Babuda zwei, die sich das Wohnzimmer teilten, in dem sie ihre Schüler empfingen und Bücher übersetzten – und die es während ihrer schlimmsten Auseinandersetzungen genauso teilen mussten wie in den friedlichen Zeiten – und das jeden Abend mit viel Aufwand, mit Geschiebe und Gezerre in ein Schlafzimmer verwandelt wurde.
Der Laubengang im zweiten Stock gehörte nicht nur zu unserer, sondern auch zur Wohnung von Nadja Alexandrowna, eine alleinstehende, kinderlose Witwe, von der wir uns nicht vorstellen konnten, dass sie jemals jung gewesen war, und die den fatalen Fehler begangen hatte, sich während ihrer Studienzeit an der Moskauer Lomonossow-Universität in einen georgischen Gitarrenlehrer zu verlieben. Sie verlor ihren Kopf und ihren Verstand und reiste ihm in seine sagenumwobene Heimat nach, die von vielen ihrer dichtenden Landsleute besungen und bewundert worden war. Nachdem die stürmische Liebe verklungen und die kopflose Leidenschaft abgeebbt waren, quartierte der Gitarrenlehrer seine russische Trophäe bei seiner älteren Schwester ein und verschwand wochenlang in den Armen anderer Damen. Anscheinend war Nadjas Liebe hartnäckiger und unerschütterlicher als die ihres Mannes, denn sie hielt ihm zu seinen Lebzeiten und auch darüber hinaus die Treue und fand jedes Mal irgendeine Entschuldigung für sein unverzeihliches Verhalten. Auch als er mit zwei Frauen uneheliche Kinder zeugte und sie ab und an mit nach Hause brachte, fand Nadja, dass es dem »armen Mann« zustehe, da sie selbst aufgrund einer schwerwiegenden Kinderkrankheit keine bekommen konnte. Mit etwas sehr Entscheidendem musste dieser dauerfeiernde Mann seine fragile und ätherische Frau entschädigt haben, denn anders war ihre bis zur Dummheit aufopferungsvolle Liebe nicht zu erklären. Nach dem Tod der unverheirateten Schwester des Gitarristen und nach dessen Ableben durch Leberzirrhose blieben Nadja die dunkle, feuchte Zweizimmerwohnung, ihre Zimmerpflanzen und ihre Katzen – und ihr Russisch, das sie bis zu ihrem Lebensende nie gegen Georgisch eintauschte, ebenso wenig wie sie es sich nehmen ließ, uns Kinder mit Nougat- und Sauerdornbonbons zu beschenken.
Ich weiß bis heute nicht, warum die Babudas ihre distanzierte Haltung ihr gegenüber bewahrten, sie waren zwar stets freundlich zu ihr, liehen ihr hin und wieder etwas Mehl, Backpulver oder Eier, aber eine gewisse Skepsis blieb bestehen. Wahrscheinlich lag es daran, dass sich die beiden noch sehr gut an ihren Mann und ihr »unwürdiges« Leben an seiner Seite erinnerten und ihr diese weibliche Hingabe, die an nahezu religiöse Selbstaufopferung grenzte, nicht verzeihen konnten. Und obwohl sie viel gemeinsam gehabt hatten – auch Nadja war eine Frau der Literatur und der erhabenen Verse –, schlossen sie keine Freundschaft, und so blieb Nadja Alexandrowna bis zu ihrem Tod bloß eine Nachbarin, die man nur zu großen Festen einlud und der man an Ostern rote Eier und Paska brachte.
Eine Etage tiefer, im ersten Stock, wohnten die Basilias. Was wohl aus ihnen geworden ist? Die voluminöse Nani, nebenberuflich Verkäuferin in einem städtischen Gastronom irgendwo auf der anderen Flussseite, hauptberuflich Schwarzmarkthändlerin und die gewiefteste Frau des ganzen Hofs (nicht einmal Iras Mutter konnte da mithalten). Ich erinnere mich an die bunten Kittel, die sie immer trug. Sie schaffte es wahrlich, mit allen und allem Handel zu treiben: Bat man sie um ein bisschen Salz, wollte sie im nächsten Augenblick ein halbes Kilo Reis als Gegenleistung. Sie konnte jeden dazu überreden, irgendetwas zu kaufen, und vor allem die Frauen des Hofs waren ihr hörig, nahmen ihre Übellaunigkeit, ihre derbe Art geduldig hin, denn gegen eine angemessene Bezahlung konnte sie alles auftreiben, was das Herz begehrte und was der sowjetische Staat nicht hergab: von Kinokarten für eine geschlossene Filmvorführung bis hin zu tschechoslowakischer Unterwäsche. Von ihrem Mann Tariel war meist nur der imposant behaarte Rücken zu sehen, denn auch in seiner Freizeit war er unermüdlich an seinem KAMAZ zugange, der zum Groll aller Kinder immer im Hof parkte und beim Spielen störte. Ihr einziger Sohn, Beso, hatte weder das Talent seines Vaters noch das seiner Mutter geerbt; er war ein langsamer Zeitgenosse, träge und bewegungsfaul, der sich immerzu im Schritt kratzte und schon als kleiner Junge eine ausgeprägte Neugier allem Sexuellen gegenüber zeigte.
Wohnten die Basilias Wand an Wand mit Zizo? Ja, natürlich, so muss es gewesen sein, denn später wurde der Wohnraum dieser alten Dame durch Iras Familie, die Schordanias, beschnitten, und der erste große Hofskandal war vorprogrammiert. Zizo habe ich nie gemocht, musste mir aber immer alles von ihr gefallen lassen, so hatte man es mir und den anderen Kindern des Hofes eingebläut. Denn diese alte alleinstehende Dame mit albernen Hütchen auf dem Kopf und einem stets jammernden Tonfall hatte vor Jahren ihren einzigen Sohn bei einem Autounfall verloren, und dieser Verlust verlieh ihr in den Augen der Hofgemeinschaft einen Märtyrerinnenstatus. Sie durfte, was die anderen nicht durften: schimpfen und klagen, mahnen und eben jammern. Von ihrer Zweizimmerwohnung trat sie später ein Zimmer an Iras Mutter Giuli ab. Aber ihr war damals sicherlich nicht klar gewesen, dass diese ihr dadurch den Zugang zu ihrer Wohnung über das Treppenhaus versperren und zum ewigen Klagen und Stöhnen auf dem Weg über die Wendeltreppe verdammen würde.
Читать дальше