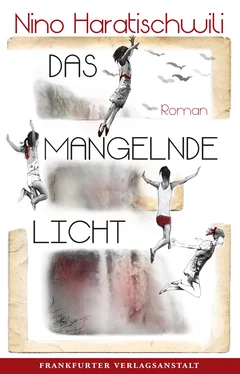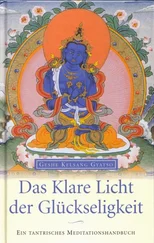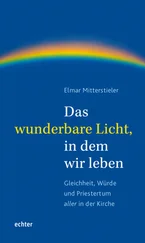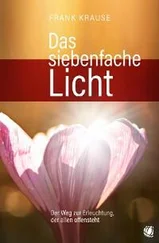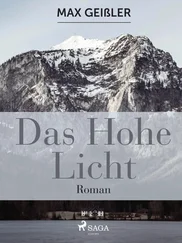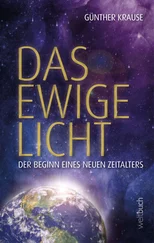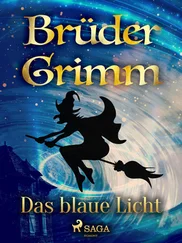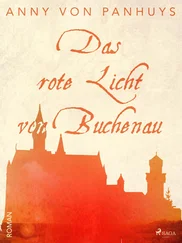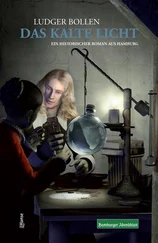1 ...6 7 8 10 11 12 ...40 Das ganze Erdgeschoss gehörte den Tatischwilis mit ihrer geräumigen Wohnung, dieser nahezu unwirklich vorbildhaften Vorzeigefamilie, der man trotz ihrer übertriebenen Gastfreundschaft, ihrer Geselligkeit und den beeindruckenden Kochkünsten der Familienmutter im Hof mit großem Misstrauen begegnete. Die Ablehnung ging vor allem von den Vertretern der Intelligenzija des Hofes aus und war dem Beruf geschuldet, den der Familienvater einst ausübte, Dawit, der immer nur »der Tschechowik« genannt wurde, ein Wort, dessen Bedeutung ich erst viele Jahre später erfassen sollte – der sowjetische Inbegriff für staatliche Verdorbenheit und Korruption. Diese Menschen waren die »Kapitalistenschweine« der Sowjetära und jedem »ehrbaren« Menschen ein Dorn im Auge. Hinzu kam, dass diese Familie eine Spur zu perfekt schien, und so war man unermüdlich darum bemüht, Fehler und Probleme dieser Musterfamilie aufzudecken.
Anna Tatischwili saß zwei Bänke vor mir und war die inoffizielle Prinzessin der Klasse, eine Schönheit und die Klassenbeste über viele Jahre, bis Ira ihr wenigstens diesen letzten Status streitig machte. Ihr Bruder Otto, der Prinz der Familie, war ein kleiner Sadist. Wie ich ihn hasse, wie mich heute noch dieses Unbehagen befällt, wenn ich an ihn denke. Dieser ewig Flüchtige. Wie es sich wohl mit seiner Schuld leben lässt?
Schon als Kind offenbarte er gewisse Auffälligkeiten, aber man gab sich mit endlosen Rechtfertigungen seiner Eltern zufrieden. Hieß es nicht damals, er sei halt ein »besonderer Junge«, mit dem man viel Geduld bräuchte? Nur einmal, als er eines Tages die Katze von Nadja Alexandrowna im Auffangbecken unter dem Wasserhahn im Hof ertränkte – der kleine Tarik war Zeuge der Folter geworden und hatte uns davon erzählt –, verlor man diese schier endlose Geduld und prophezeite, es würde »kein gutes Ende mit ihm nehmen«. Wie recht sie doch hatten.
Das Häuschen auf Stelzen rechter Hand – auch das war ein unausgesprochenes Gesetz – beherbergte die Absteiger und Außenseiter. Dieses Gesetz wurde erst durch den Einzug von Lika Pirweli und ihren beiden Mädchen auf den Kopf gestellt. Zuvor wohnten dort nur der armenische Schuster Artjom, der von Frau und Kindern wegen seiner übermäßigen Liebe zum Alkohol verlassen worden war, und die kurdische Familie, die ich als Kind namenlos glaubte, denn keiner nannte sie bei ihrem Vor- oder Familiennamen, sondern immer nur »die Kurden«. Arbeitete der Vater nicht in den Schwefelbädern, oder bringe ich etwas durcheinander? Ich sollte Ira fragen, ja, sie hat ein phänomenales Gedächtnis, sie wird es wissen. Die älteren Kinder der kurdischen Familie, insgesamt waren es wohl fünf oder sechs, waren alle bereits ausgezogen und teilweise verheiratet. Tarik, der Jüngste, war der Nachzügler, und man munkelte, die Eltern hätten die Sache mit der Fortpflanzung bereits als abgeschlossen betrachtet, als er sich der Welt ankündigte. Tarik mit der Brille mit den dicken Gläsern, die seine Augen in winzige Punkte verwandelte, war ein unglaublich lieber und höflicher Junge, über den völlig zu Unrecht allerlei Schwachsinn im Umlauf war, was es ihm nicht gerade leicht machte, von den anderen Kindern akzeptiert zu werden. Irgendwie war er trotzdem immer dabei, und zu jeder Jahreszeit sah man ihn im Hof spielen. Tarik war ein großer Tierfreund, der jedem Straßenköter einen Namen gab und ihn mit Leckereien fütterte, die er seinen Eltern oder den Nachbarn stibitzte. Ich weiß nicht, ob seine Mutter ihn derart abgöttisch liebte, weil er so unerwartet als spätes Glück auf die Welt gekommen war, oder weil er es im Leben nicht leicht hatte, aber sie tat es so übereifrig, dass sie Tarik sicherlich mindestens genauso im Weg stand wie all die idiotischen Gerüchte über ihn. Tarik, ja, Tarik, der Seismograph für das aufkommende Unglück, der Vorbote des Niedergangs, der das Ende unserer Kindheit einläutete.
Mein Blick wandert weiter über das Bild unseres Hofes, zur gegenüberliegenden Seite, zum roten Backsteinhaus. Die Wohnungen im roten Haus waren stabiler, schöner, sicherer, die Bewohner des roten Hauses waren Urgesteine des Hofes, und man zollte ihnen besonderen Respekt. Auch lebten dort nicht, wie bei uns, gleich mehrere Familien auf einem Stockwerk, sondern insgesamt bloß zwei – oder besser gesagt, eine Familie und Onkel Giwi, ein Name, der bei fast allen (und vor allem den älteren) Hofbewohnern grenzenlose Bewunderung auslöste, meist von einem bedauernden Kopfschütteln begleitet.
Onkel Giwi … ich muss lächeln und lasse mir diesen Namen auf der Zunge zergehen, auf der sich in Sekundenschnelle der Geschmack meiner Kindheit ausbreitet, das Aroma von sahnigem Eis, von Buchweizen, von Sauerdornbonbons und Estragonlimonade. Onkel Giwi schien schon immer in diesem Backsteinhaus gelebt zu haben, seit der Zarenzeit, vor allen Revolutionen und vor den Bolschewiken. Im Sommer wie im Winter standen seine Fenster offen und klassische Musik drang aus seiner Wohnung. Er galt als Held des Zweiten Weltkrieges, dekoriert mit etlichen Tapferkeitsmedaillen; bis nach Berlin sei er gekommen, General im Ruhestand und passionierter Pianist – ein Autodidakt, wurde meist ehrfürchtig hinzugefügt. Eine Wucht von einem Mann, so kategorisierten ihn meine Babudas, und ich unterstellte den beiden, in diesen hochgewachsenen, hageren Mann mit den hängenden Schultern und dem watscheligen Gang verliebt zu sein.
Vor allem Eter, Babuda eins, die pedantische und strengere meiner beiden Großmütter, bei der ich mir am allerwenigsten vorstellen konnte, dass sie zu irgendwelchen romantischen Gefühlen imstande war, wurde regelrecht schwach, sobald das Gespräch auf Onkel Giwi kam, und wer weiß, vielleicht hätte sie auch tatsächlich sein Herz erobern und mit ihm ununterbrochen über die Erhabenheit der Musik und der deutschen Sprache plaudern können, wäre da nicht ein Haken gewesen, ein unüberwindbares Hindernis, das es ihr unmöglich machte, eine ernsthafte Beziehung mit ihm in Erwägung zu ziehen: Onkel Giwi war überzeugter Stalinist und hatte nicht einmal nach der Zerschlagung des Stalinkults dessen Porträt von der Wand abgehängt, unter das er immer eine Vase mit frischen Blumen stellte.
Ja, dieser galante, kinderlose Witwer mit Veteranenrente und einem Faible für Bach und das Schachspiel verehrte den Massenmörder, der Eters Leben ruiniert und ihre Zukunft zerstört hatte. Immer wenn die Dinge in den Augen von Onkel Giwi in eine gefährlich falsche Richtung liefen, wurde der »stählerne Mann« herbeizitiert. »Würde er nur sehen, welchen Abgrund das Ganze hinunterrollt!«, stöhnte er, wenn er morgens am offenen Fenster die Zeitung las oder den Nachrichten im Radio lauschte. »Seine eiserne Hand, und alles wäre wieder im Lot.« Diese Ausrufe hinderten die meisten betagten Damen des Viertels nicht daran, von seinen feinen Manieren und seinem adretten Kleidungsstil zu schwärmen, auch sprachen sie alle mit offensichtlicher Rührung von seiner grenzenlosen, herzzerschmetternden Liebe zu seiner leider, leider zu früh verstorbenen Frau. Welch eine Liebe, welch Hingabe, welch Zärtlichkeit! Und während sie feuchte Augen bekamen und ihr Mund sich zu einem sehnsüchtigen Strich verzog, kam der Verdacht auf, dass sie sich, ohne es sich vielleicht selbst einzugestehen, an die Stelle dieser ewigen Julia wünschten, der es nicht vergönnt gewesen war, alt zu werden und mit Giwi Nachkommenschaft zu zeugen.
Seine Sprache, die etwas gekünstelt und altmodisch wirkte, brachte uns Kinder immer zum Lachen, und manchmal klingelten wir unter allerlei blödsinnigen Vorwänden an seiner Tür, um mit ihm ins Gespräch zu kommen und seine komplizierten Sätze zu hören. »Der Frühling ist mit seinen zarten Pudertönen in unserem Hof erblüht, sehen Sie hin, Sie unschuldigen Geschöpfe«, sagte er einmal im Vorbeigehen zu uns, und wir prusteten los, kaum dass er hinter seiner Holztür verschwunden war. »Ich wünsche Ihnen allen ein Jahr voller Herzensangelegenheiten, die sich zu Ihrer größtmöglichen Zufriedenheit fügen«, begrüßte er uns einmal zu Neujahr, und wir wiederholten diese Worte tagelang, konnten uns nicht mehr einkriegen. Und sofort muss ich an den Tag denken, an dem er das alte Heft vor mich hinlegte …
Читать дальше