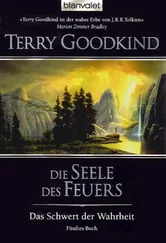Der nächste Teil des Weges fordert meine ganze Aufmerksamkeit, weshalb ich die immer gleichen Gedanken zur Seite schiebe. Ist der Anstieg des Pfades schon beschwerlich gewesen, so wird er nun zu einer Herausforderung. Besorgt ziehe ich die Zügel fester an und klammere mich an den Knauf meines Sattels.
Die Krallen der Reitechsen graben sich in die Erde. Sie haben keine Schwierigkeiten, den steilen Anstieg zu überwinden. Die Soldaten hinter uns fallen allerdings zurück. Ich blicke über meine Schulter, erhalte durch die Neigung freie Sicht auf sie. Ich muss aufpassen, das Gleichgewicht in meinem Sattel nicht zu verlieren, und beobachte, wie die Abstände zwischen den Reihen sich vergrößern. Nach und nach dehnt sich die Kolonne hinter uns auf die doppelte Länge. Die Anstrengung ist den Soldaten deutlich anzusehen.
Vielleicht hat die Zeit des Friedens zu lange gedauert. Möglicherweise haben wir uns zu sehr auf unsere Götter verlassen. Es ist mehrere Jahrzehnte her, seit wir das letzte Mal von einem verfeindeten Volk angegriffen wurden. Dieser Krieg trifft uns unvorbereitet. Ich bete, dass das unseren Sieg nicht unmöglich macht.
Mit schwerem Herzen wende ich mich nach vorne. Der Wald, der uns am Rand des Weges begleitet, drängt immer näher. Der Durchgang wird schmaler, doch noch können wir die Viererreihe aufrechterhalten. Hoffentlich ändert sich daran nichts, denn das würde einen Angriff auf uns erleichtern. Diese Reise ist bislang ohne große Zwischenfälle verlaufen. So kurz vor dem ersten Ziel darf sich daran nichts ändern.
Ganz unerwartet öffnen sich die Reihen der Bäume. Beim Weiterreiten müssen wir einen letzten Anstieg überwinden. Dann liegt uns die Welt zu Füßen. Wir befinden uns auf dem höchsten Punkt des Berges, der in einem Halbbogen links und rechts von uns weiterwächst. Das ermöglicht uns einen Blick über das, was vor uns wartet.
Ein schmaler Pfad schlängelt sich in die Tiefe, die von den Flanken des Berges umarmt wird. Nach ein paar Hundert Armlängen beginnt erneut ein Wald, der sich allerdings von dem unterscheidet, den wir bereits durchquert haben. Bäume ragen aus dem Nebel, der den Boden in eine trübe Suppe verwandelt. Ich weiß, dass wir dort auf jeden unserer Schritte achten müssen. Ein Sumpf, älter als die Menschheit, verschlingt alles, was sich zu nahe an ihm heranwagt.
Angeblich führt ein Weg durch diese gefährliche, graue Brühe. Noch habe ich allerdings von niemandem gehört, dem es gelungen ist, wieder lebend aus dieser feuchten Dunkelheit zu gelangen. Doch selbst wenn es gelingen sollte, einen Weg aus befestigtem Boden zu entdecken, wird man vom Nebel umhüllt. Der Pfad verschwindet. Ein falscher Schritt, und der Morast zieht einen in die Tiefe. Der Verstand wird von den Schwaden benebelt. Man vergisst, warum man sich überhaupt in dieses Moor gewagt hat. Nein, es ist kein Ort, an den man sich leichtfertig begeben sollte.
Und doch ist es das Zwischenziel unserer Reise.
In der Nähe des Sumpfes existiert keinerlei Leben. Kalt und unwirtlich liegt das mit Nebelschwaden verdeckte Moor inmitten unserer fruchtbaren Heimat. Während unserer Reise haben wir saftige Felder gesehen, deren Früchte man uns geschenkt hat, sobald der Fürst erkannt worden war. Äcker waren mit hohen Getreideähren bestückt, aus denen man die uns überlassenen Brote gebacken hatte. Flüsse hatten uns Nahrung im Überfluss gewährt. Doch das Land dort unten ist scheinbar in einem großen Radius vergiftet.
Mit einer Handbewegung lässt der Fürst seine Männer anhalten. Dann befiehlt er seine Berater zu sich. Irgendwo hier in der Nähe werden wir unser Lager aufschlagen. Ich kenne die Gesichtspunkte nicht, nach denen der geeignete Platz ausgewählt wird. Es ist mir auch egal. Für den Fall, dass man mich nach meiner Meinung fragen sollte, habe ich meinen Großvater bereits informiert. Sollte man sich an mich wenden, muss ich Oremazz lediglich kanalisieren, damit er mir die Worte einflüstert, mit denen ich den richtigen Ratschlag geben kann.
Meine Gedanken beschäftigen sich mit der Aufgabe, die ich allein erfüllen muss. In meinem Magen kribbelt es vor Aufregung. Meine Ausbildung sollte mich auf diesen Moment vorbereiten. Doch einmal mehr habe ich das Gefühl, dass das Misstrauen meines Großvaters in meine Fähigkeiten gerechtfertigt ist. Wie soll ich an mich glauben, wenn er mir eingepflanzt hat, niemals gut genug zu sein?
Der Nebel wabert. Man könnte glauben, dass er seine Finger ausstreckt, dass er sich neugierig hochreckt, um zu überprüfen, was auf dem Hügel über ihm vorgeht. Unter Umständen ist diese Vorstellung nicht einmal so unsinnig, wie sie klingen mag. Dort unten in den Sümpfen befindet sich eine Quelle der Magie. Die Macht, die darin wohnt, ist nicht von dieser Welt. Nein, die Wesen, die dort unten hausen, sind zu weit mehr in der Lage, als ein paar arme Seelen zu verwirren und ins Unheil zu stürzen.
Nebelseelen.
Der Name wird dem Grauen nicht gerecht, das sie verbreiten. Eine Armee aus verlorenen Seelen, die sich nach ihrem Tod dagegen entschieden haben, Teil der Armee der Engel zu werden, oder die als unwürdig befunden wurden, Teil des göttlichen Heeres zu sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, was jemanden dazu bewegen sollte, freiwillig zu einer Nebelseele zu werden. Ein Leben in der Dunkelheit in alle Ewigkeit. Der Hunger, die Seelen von Menschen für sich zu vereinnahmen, sich in ihren Verstand einzunisten und von ihnen Besitz zu ergreifen, bis sie dem Wahnsinn anheimfallen. Es ist ein hoffnungsloses, sinnloses Dasein. Doch ich verstehe auch nicht die Menschen, die sich ganz dem Bösen hingeben. Dazu gehören die Nebelseelen ohne Zweifel. Sie sind die Armee der Dunkelheit.
In früheren Jahren sind die Nebelseelen Gerüchten zufolge durch die Lande gezogen und haben ihren giftigen Atem überall verteilt. Wer sich auf ihre Verlockungen eingelassen hat, verlor seine Seele bereits vor dem Tod. Überall existierten Personen, die nur noch eine fleischliche Hülle ohne eigenen Willen waren. Niemand soll vor ihnen sicher gewesen sein.
Jetzt allerdings ist ihr König der Schlüssel, der uns siegreich aus dem bevorstehenden Krieg heraustreten lassen soll.
»Mach kein so finsteres Gesicht«, fordert eine Stimme neben mir. »Man könnte annehmen, du wärest wegen irgendetwas beunruhigt. Dabei ist das mit Sicherheit nicht der Fall.«
Ich wende mich Elevander zu und bemühe mich um ein Lächeln. Mein bester Freund ist aus der Reihe seiner Truppe getreten, um mit mir sprechen zu können. »Natürlich nicht. Tut mir leid, wenn meine Gedanken abgeschweift sind. Der heutige Ritt war ziemlich anstrengend. Ich will mir nicht vorstellen, wie erschöpft du sein musst.«
Er zuckt mit den Schultern. »Mein Los habe ich mir selbst ausgesucht, als ich mich für diese Einheit entschieden habe.«
»Wir beide wissen, weshalb du diese Wahl getroffen hast.« Mir ist nichts anderes übriggeblieben, als in direkter Nähe zu unserem Fürsten zu reiten. Das gilt allerdings nicht für meinen besten Freund.
Elevander wollte mich nicht allein lassen. Er besteht darauf, mich im Auge zu behalten. Nicht, weil er mir nicht vertrauen würde. In seinen Augen kann ich nichts falsch machen. Er versucht, auf mich aufpassen, damit ich in meiner Unsicherheit keinen Fehler begehe. Wie immer glaubt er unerschütterlich an mich. Er wird dafür sorgen, dass ich den Respekt der Soldaten oder gar unseres Anführers nicht verliere, wenn sich so wie jetzt meine Anspannung auf meinem Gesicht zeigt.
Womit habe ich einen treuen Freund wie ihn verdient?
»Ich bin froh, dass ich hier vorne marschieren kann«, erklärt Elevander. »Wie viel Staub die Soldaten weiter hinten wohl schlucken müssen? Seit Tagen haben wir uns alle ein vernünftiges Bett gewünscht. Doch die Männer, die am Ende unseres Trupps gehen, haben noch ein härteres Schicksal. Wir brechen in den Morgenstunden als Erstes auf und erreichen den Rastplatz auch wieder vor den anderen. Die Männer hinten müssen mit uns zum Abmarsch bereit sein, stehen dann aber sinnlos herum, bis sie an der Reihe sind. Am Abend sind sie die Letzten, die ihr Lager errichten.«
Читать дальше