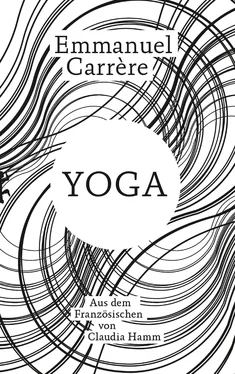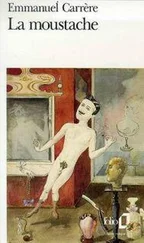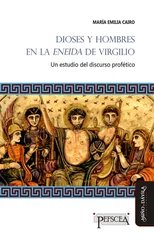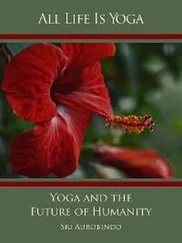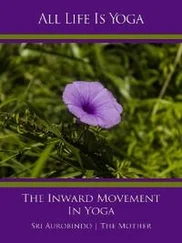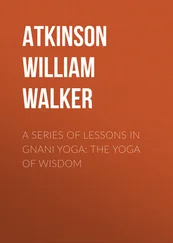Niemand steht auf. Niemand geht. Ich ahne nicht, dass ich vier Tage später der Erste sein werde.
Die Edle Stille hat begonnen. Auf blechernen Servierwagen schieben die Kurshelfer Riesenportionen Reis und gekochtes Gemüse herein, das man mit Sojasoße, Bierhefe oder Gomasio würzen kann. Jeder nimmt sich eine Schale oder einen Teller vom Stapel, den er nach Gebrauch nicht abwäscht, sondern einfach in eine der Wannen stellt, die von den Kurshelfern später weggetragen werden. Da alle materiellen Verpflichtungen auf ein Minimum reduziert sind, hat man nichts, aber auch gar nichts anderes zu tun als zu schweigen und den Blick nach innen zu richten. Dem der anderen weicht man aus. Man starrt auf seinen Teller, isst sehr langsam, kaut sehr langsam – eine Gewohnheit, an der man sonst die Kontrollfreaks erkennt und die ich mir seit Jahren relativ erfolglos zuzulegen versuche. Nach beendeter Mahlzeit geht man früh schlafen. Jeder begibt sich gesenkten Blickes in seinen Bungalow oder seinen Schlafsaal. Um acht Uhr abends liege ich in meinem Bett, ohne Buch, ohne Ablenkung und natürlich ohne Lust zum Schlafen. Ich betrachte den Klotz Nacht, der sich im Fenster vor mir abzeichnet. Ich betrachte die kleine Zwillingsfigur, die ich in das leere Regal wie auf einen Hausaltar gestellt habe. Eigentlich hätte ich jetzt Lust, so wortgetreu wie möglich die Rede des sympathischen jungen Manns und meine Eindrücke von diesem Abend aufzuschreiben. War es richtig gewesen, das Spiel mitgespielt und kein Notizbuch eingesteckt zu haben? Ja, denn das hätte geheißen, aus der Erfahrung eine Reportage zu machen. Gleichzeitig ist es lächerlich, mir in die Tasche zu lügen: Was ich hier mache, ist eine Reportage. Oder sagen wir: Es ist auch eine Reportage. Ich liege auf der Lauer. Ich bin hier, um Stoff für mein Buch zu sammeln, und ob ich mir Notizen mache oder nicht, ändert daran nichts, denn was sich zu erinnern lohnt, wird meiner Meinung nach auch erinnert werden. Das also ist nicht die Frage. Die Frage ist eher, und ich stelle sie mir nicht zum ersten Mal: Gibt es einen Widerspruch oder sogar eine Unvereinbarkeit zwischen dem Meditieren und meinem Beruf, dem Schreiben? Werde ich während der nächsten zehn Tage meine Gedanken vorüberziehen lassen können, ohne sie festzuhalten, oder werde ich ganz im Gegenteil um jeden Preis versuchen, sie festzuhalten – also genau das tun, was man nicht tun sollte, weil es das exakte Gegenteil von Meditation ist? Werde ich mir ständig im Geist Notizen machen? Wird während dieser zehn Tage der Meditierende den Schriftsteller beobachten oder der Schriftsteller den Meditierenden? Ein großes, wirklich großes Thema, das mir zusetzt und über dem ich schließlich einschlafe.
In Aussicht auf ein Leben ohne Handy habe ich mir in einem indischen Ramschladen in der Rue du Faubourg-Saint-Denis einen großen Wecker gekauft – das einfachste und billigste Modell, eins, das ticktack macht. Ich habe ihn auf Viertel nach vier gestellt, doch um Viertel nach vier bin ich längst wach, tatsächlich habe ich kaum geschlafen. Charles de Foucauld hatte sich zum Prinzip gemacht, zu jedweder Uhrzeit, zu der er nachts aufwachte, aufzustehen und davon auszugehen, dass der Tag begonnen hat – eine radikale Art, Schlafstörungen zu bekämpfen. Auch wenn ich mich nicht jedes Mal dazu aufraffen kann, versuche ich, es ihm gleichzutun. In Paris stehe ich noch vor Tagesanbruch auf und gehe, ohne Licht und Lärm zu machen, in mein Arbeitszimmer. Ich bin gern der einzig Wache in einem schlafenden Haus, vor allem im Winter, wenn es draußen noch dunkel ist und die Heizung ein bisschen benommen macht und ich mich auf mein Zafu setze und meinen Atem beobachte und alles, was mir durch den Kopf geht. Dieser Übergang vom Schlaf zum Wachzustand hält etwa eine halbe Stunde an, dann will der Körper sich regen. Zuerst sind es kleine Bewegungen, doch nach und nach werden sie ausladender und verwandeln sich unmerklich in Asanas, wie man die Yogastellungen nennt. Früher habe ich viele Kurse besucht, inzwischen übe ich allein am frühen Morgen und ganz nach Belieben. Ich mache die Stellungen, auf die ich gerade Lust habe, und so, wie ich lustig bin, so, wie sich eine aus der anderen ergibt und mehr oder weniger natürlich in sie übergeht. An guten Tagen fühlt man sich dabei wie ein Tier, das sich streckt. An schlechteren flüchtet man in Routinebewegungen, ein Grundgerüst, gewisse Vorlieben – aber immerhin. Je nach Stimmung gibt es statische Tage und dynamische, Tage im Stehen und Tage im Sitzen. Der Vorteil eines Kurses ist, dass man korrigiert wird, der Vorteil des Selbstübens ist, dass man lernt, sich selbst zu korrigieren und darauf zu hören, wonach der Körper verlangt. Der Körper hat 300 Gelenke. Der Blutkreislauf strömt durch 96 000 km Arterien, Venen und Blutgefäße. Es gibt 16 000 km Nerven. Die aufgefaltete Oberfläche der Lungen entspricht der eines Fußballfelds. Yoga hat zum Ziel, das alles nach und nach kennenzulernen. Und es mit Bewusstsein, Energie und dem Bewusstsein für die Energie zu erfüllen. All das ahnt man nicht, wenn man sich zum ersten Mal zu einem Yogakurs anmeldet. Man hofft, etwas für seine Gesundheit zu tun und entspannter zu werden. Man hofft, ein bisschen strategische Tiefe zu gewinnen – so nennen Militärs das mögliche Rückzugsgebiet im Fall eines Angriffs auf die Grenzen: Deutschland, das ein Binnenstaat ist, hat sehr wenig davon, Russland dagegen sehr viel, das erklärt teilweise den Ausgang des Zweiten Weltkriegs und es ist gut auf die individuelle Ebene übertragbar. In der Reaktion auf Aggressionen von außen hat jeder mehr oder weniger viele Rückzugsmöglichkeiten, mehr oder weniger strategische Tiefe. Bessere Gesundheit, innere Ruhe und strategische Tiefe erreicht man, indem man Yoga macht, doch diese Vorteile sind nur Nebenprodukte und Begleiterscheinungen. Selbst unwissentlich und selbst wenn man sich, wie ich, in den Bergen mit Kühen an die leicht begehbaren Pfade hält, ist man schon auf dem Weg zu etwas anderem.
In dieser Nacht also kein Yoga, keine Meditation; ich bleibe in Embryohaltung und ein bisschen verzagt im Bett liegen und warte, dass der Wecker klingelt. Er klingelt, ich stelle ihn aus. Ich starre auf das Ziffernblatt und schaue zu, wie der Sekundenzeiger von Strich zu Strich zuckt: Man hat nicht mehr oft Gelegenheit, einen alten Mechanismus zu beobachten, der nicht digital funktioniert. 4.20 Uhr: Ich gönne mir noch fünf Minuten. Doch bevor diese fünf Minuten um sind, dringt ein außergewöhnlich tiefer, außergewöhnlich voller und außergewöhnlich raumgreifender Ton durch die Nacht. Man könnte meinen, ein sehr schwerer Stein sei ins träge Wasser eines schwarzen Sees gefallen und bilde dort langsam fliehende Kreise. Und die Kreise breiteten sich immer weiter aus und ihre Schwingungen setzten sich immer weiter fort. Sie hypnotisieren mich. Ich habe den Eindruck, sie nehmen Besitz von mir und werden mich nie wieder verlassen. Dann fließen sie langsam zurück. Es ist nicht klar, an welchem Zeitpunkt das Zurückfließen begonnen hat, es ist wie ein Atemzug, der beim Einatmen ans Ende gelangt ist und sich in ein Ausatmen verwandelt. Der Ton wird langsam leiser, doch während er leiser wird, gewinnt er noch an Tiefe und Fülle. In manchen Yogakursen beginnt man die Sitzung, indem man den Laut OM singt, das ist der Grundton des Hinduismus, ein auf seinen einfachsten Ausdruck reduziertes Mantra. Lange hat mich das genervt, genau wie wenn ich Kirchenlieder singen sollte, doch man muss zugeben: Den Körper von der Schwingung dieses Tons durchströmen zu lassen, hat eine starke Wirkung. Die Schwingung des Gongs ist das instrumentale Äquivalent, und mir wird bewusst, dass er gerade erst zum zweiten Mal angeschlagen wurde und dass der Klangsee, in dem ich seit fast einer Minute bade, der Nachhall eines einzigen Schlags ist. Also stehe ich auf, ziehe mich hastig an und ziehe den Vorhang auf. Weiße Kugellampen säumen den Weg durch den Garten. Im Regen treten Gestalten aus den Bungalows und laufen langsam zur Halle. Man könnte meinen, man sei in einem Zombiefilm.
Читать дальше