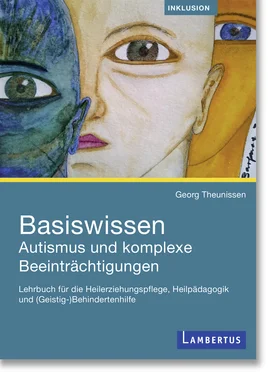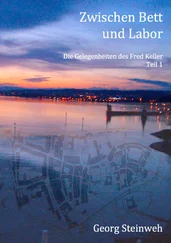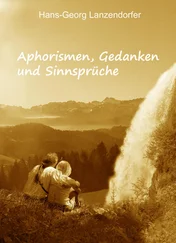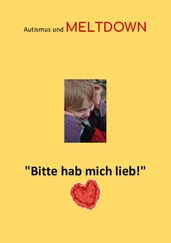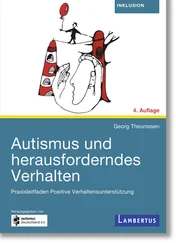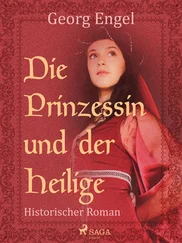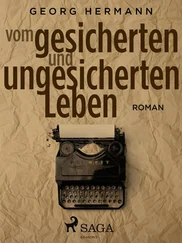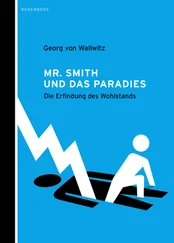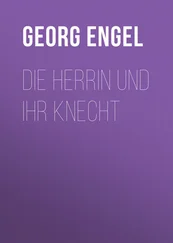Das gilt ebenso für eingeschränkte Kommunikationsfähigkeiten, die vermutlich 25 % bis 30 % aller Personen mit „Doppeldiagnose“ („Intelligenzminderung“ und „Autismus-Spektrum-Störung“) betreffen (vgl. Jack & Pelphrey 2017, 2).
Letztlich kommt es für die Praxis aber nicht darauf an, ob wir es im Rahmen komplexer Beeinträchtigungen mit dieser „Doppeldiagnose“ oder umgekehrt mit Autismus und Lernschwierigkeiten zu tun haben. Entscheidend ist, jede betroffene Person in ihrem So-Sein, ihren Beeinträchtigungen und Stärken zu erschließen, um ihr durch geeignete Unterstützungsmaßnahmen eine optimale Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen. Wieweit es dabei den Autismus zu priorisieren gilt, soll im Folgenden diskutiert werden.
Zur Frage der primären Behinderung
In den letzten Jahren mehren sich in der klinischen Fachwelt Stimmen, Autismus als eine „Basisstörung“ (Tebartz van Elst 2015) zu betrachten, die für weitere psychische Störungen wegbereitend sein kann. Wenngleich aus der Sicht der Selbstvertretungsbewegung (ASAN) Autismus nicht per se eine Störung darstellt, teilen gleichfalls Betroffene die Auffassung, dass das autistische Sein als Ausdruck von Neurodiversität für psychosoziale Probleme, psychische Krisen oder spezifische Erkrankungen besonders sensibel sein kann und bei komplexen Beeinträchtigungen (Lernschwierigkeiten, mehrfachen Behinderungen, psychischen Störungen) priorisierte Beachtung finden sollte (vgl. Kapp 2020; Craine 2020; Pripas-Kapit 2020).
Begründen lässt sich dies durch die Spezifizität und Einzigartigkeit der Merkmale des Autismus-Spektrums, die in pädagogischen und anderen sozialen Situationen häufig deutliche Normabweichungen auf der Verhaltensebene hervorrufen, welche nicht nur einen verstehenden Umgang, sondern ebenso die Bereitschaft erfordern, Autismus als menschliches „So-Sein“ einer Neurodiversität anzuerkennen und ggf. unkonventionelle Maßnahmen (z. B. in Bezug auf Kontextveränderungen) zuzulassen (vgl. Schmidt 2020; Vero 2020).
Nach unseren Erfahrungen werden Kinder mit der Diagnose „frühkindlicher Autismus“ ebenso wie Heranwachsende, die als „geistig behindert“ und zugleich als „autistisch“ gelten, im Erwachsenenalter zumeist in Einrichtungen der Behindertenhilfe untergebracht, die sich auf die Pflege, Unterstützung und Förderung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf spezialisiert haben. Diese Spezialisierung hat eine lange Tradition und reicht zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, als erste „Idiotenanstalten“ gegründet wurden (vgl. Theunissen 2021c). Im Zuge dieser Entwicklung kam es zu einer „Psychiatrisierung“ der Behindertenhilfe, die den meisten Menschen mit Lernschwierigkeiten oder komplexen Beeinträchtigungen weitaus mehr geschadet als genutzt hatte.
Heute gilt diese Phase als weithin überwunden. Dazu haben gesellschaftspolitische Entwicklungen, insbesondere Einflüsse von Empowerment-Bewegungen Eltern behinderter Kinder, Selbstvertretungsorganisationen behinderter Menschen (People First, Self Advocates Becoming Empowered, ASAN) sowie Erkenntnisse aus der Forschung und Praxis maßgeblich beigetragen. Bemerkenswert ist eine Fülle an therapeutischen und (heil-)pädagogischen Konzepten und Methoden (vgl. Wüllenweber & Theunissen 2020; Theunissen 2021b), die der Behindertenhilfe Empfehlungen und das Rüstzeug für eine „ best practice “ bietet.
Da diese Anregungen in erster Linie die Arbeit mit kognitiv beeinträchtigten („geistig behinderten“) Personen reflektieren, besteht allerdings die Gefahr, dass bei Betroffenen, die zugleich als autistisch gelten, der Autismus gegenüber einer diagnostizierten oder angenommenen „Intelligenzminderung“ als nachrangig betrachtet wird.
In der Tat ist dieses Problem in Sonderwohngruppen 11großer Einrichtungen der Behindertenhilfe beobachtet worden (vgl. Theunissen u. a. 2018; 2019).
Was in dem Zusammenhang kritisch gesehen werden muss, ist die festgestellte Unkenntnis über Autismus, der oft nur mit repetitiven, stereotypen und zwanghaften Verhaltensweisen sowie einem selbstverletzenden oder destruktiven Verhalten assoziiert wird. Dieses klischeehafte Unwissen wirkt sich insbesondere auf kaum oder nicht-sprechende Personen ungünstig aus, die zugleich als kognitiv beeinträchtigt („geistig behindert“) und autistisch gelten. Nicht selten stoßen wir an dieser Stelle auf eine restriktive Praxis, die darauf zielt, die betroffene Person an bestehende Verhältnisse anzupassen und das (vermeintlich) autistische Verhalten „in ein nicht-autistisches umzuformen“ (Greenburg & Rosa 2020, 158). Stattdessen ist eine „verstehende Sicht und Arbeitsweise geboten, bei der es das einzigartige Set an intellektuellen, visuellen, sensorischen, kommunikativen und motorischen Fähigkeiten“ (ebd.) sowie einen atypischen Entwicklungsverlauf bei betroffenen Personen zu beachten gilt (vgl. auch Mottron 2017).
Merkbox
„Man möchte, dass Kinder mit störendem Verhalten sich an die Normalität anpassen, anstatt, wenn das Kind sich nicht verbal ausdrücken kann, zu versuchen, sein Verhalten zu verstehen und seine Botschaft zu erkennen. Wenn man aber dem, der ein störendes Verhalten an den Tag legt, mit Neugier und Interesse begegnet, und wenn man mit ihm spricht, ohne selbst von zahlreichen Diagnosen und Urteilen blockiert zu sein, dann kann der andere erzählen, worum es ihm wirklich geht“ (Johansson 2019, 393).
Genau diese Erkenntnis wird ignoriert, wenn autistische Erwachsene mit diagnostizierter oder nachgesagter Intelligenzminderung und schwerwiegendem herausforderndem Verhalten wie nicht-autistische Erwachsene mit sogenannter geistiger Behinderung nach dem „Schema der emotionalen Orientierung“ (SEO) 12untersucht und behandelt werden. Wie problematisch diese Praxis sein kann, ist dem folgenden Beispiel eines Bewohners einer therapeutischen Wohngruppe (TWG) zu entnehmen:
Ein Beispiel aus der Praxis
Der TWG-Bewohner Herr M. (Diagnose „frühkindlicher Autismus“) ist 25 Jahre alt, spricht nicht und gilt aufgrund seiner stark ausgeprägten Neigung, Dinge zu zerstören oder Kleidung zu zerreißen als massiv verhaltensauffällig. Als in der TWG sein auffälliges Verhalten eskalierte, wurde er in einer „Fachklinik für Menschen mit geistiger Behinderung“ unter anderem mit dem SEO untersucht. Das Ergebnis war, dass sein (sozio-)emotionales Verhalten dem Alter eines sechs Monate alten Säuglings zugeordnet wurde. Den Mitarbeiter*innen seiner Wohngruppe wurde empfohlen, dieses sehr frühe emotionale Entwicklungsniveau konzeptionell zu beachten. Diesem Rat folgend kam das Team zu der Überzeugung, dass es am besten sei, basale Entwicklungsprozesse durch ein Bällchenbad zu fördern und zugleich über eine Bezugsbetreuung eine entwicklungsfreundliche Beziehung aufzubauen. Gänzlich ignoriert wurden die vorhandenen Fähigkeiten und Stärken von Herrn M., sein kognitives und (senso-)motorisches Entwicklungsniveau sowie seine spezifischen autistischen Merkmale. So ist er beispielsweise in der Lage Wörter aufzuschreiben und Wünsche zu äußern. Ferner ist er ein guter Schwimmer. Außerdem zeichnet er sich durch eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe aus und scheint wohl soziale Stimmungen und Situationen rasch zu erfassen. Nach G. Vero (2020, 23 f.) würden wir ihm hier die Fähigkeit des „Sensing“ attestieren. Schon nach wenigen Wochen kündigte sich das Scheitern des reduktionistischen Ansatzes nach dem SEO an, sodass sich an der „gefängnisartigen“ Situation, der Herr M. schon seit geraumer Zeit ausgesetzt ist (vgl. Theunissen u. a. 2018, 453 ff.), bis heute nichts geändert hat.
Unser Beispiel zeigt auf, was Fehlinterpretationen oder Missverständnisse bewirken können, wenn die Entwicklung eines Menschen nur auf eine Dimension reduziert, kein Bezug zur Lebensgeschichte, zu individuellen Erfahrungen, Fähigkeiten und Stärken sowie zur Lebenssituation (z. B. institutionelle, isolierende Bedingungen; Gruppenwohnen) hergestellt und reflektiert wird. Herr M. wurde mit etwa neun Jahren als „autistisch“ diagnostiziert, jedoch schon seit seiner Kindheit immer als „geistig behindert“ und schwer verhaltensauffällig betrachtet (vgl. ebd., 423 ff.). Dadurch war letztlich im Zuge seiner Institutionalisierung der Blick für seine Fähigkeiten und Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten verloren gegangen. Das hätte durch eine Zusammenarbeit mit seinen Eltern vermieden werden können. Stattdessen wurden ihre Ansichten und wertvollen Erfahrungen mit ihrem Sohn übergangen, nicht ernst genommen und entwertet.
Читать дальше