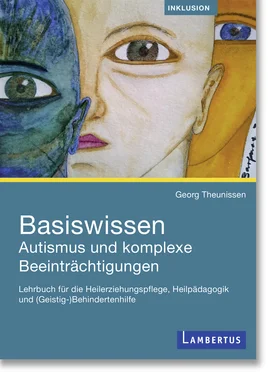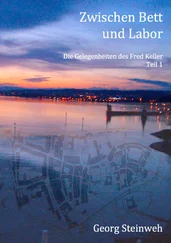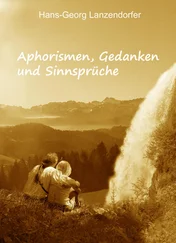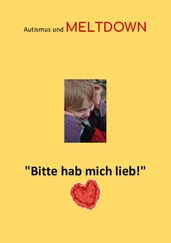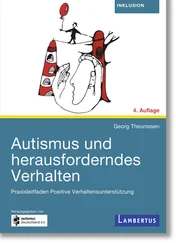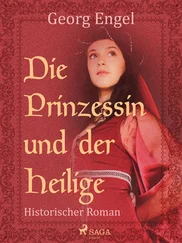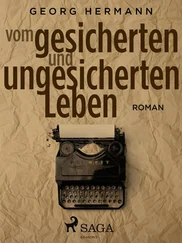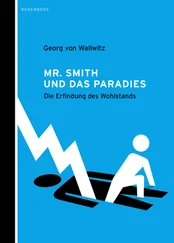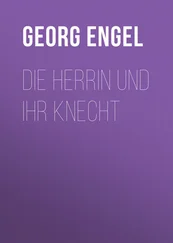Die genannten Test-Befunde stützen einerseits die Annahme einer besonderen Stärke in der Detailwahrnehmung, Detailverarbeitung und visuellen Diskriminierung bei Autist*innen mit unterdurchschnittlicher Intelligenz, die sich aus allen anderen Untertests der Wechsler-Verfahren ergibt. Andererseits lassen sie den Schluss zu, dass die Intelligenz das ist, was ein Test misst (vgl. Liungman 1973, 13; Yam 2000, 6) und dass vor allem bei nicht-sprechenden Menschen aus dem Autismus-Spektrum sprachgebundene Verfahren gänzlich ungeeignet sind, einen globalen IQ-Wert zu bestimmen.
Daher wird heute empfohlen, die Intelligenz bei autistischen Personen (insbesondere bei Verdacht auf unterdurchschnittlicher Intelligenz) mit sprachfreien Tests zu messen (vgl. Soulières et al. 2011; Mottron 2011). Allerdings scheinen diese Verfahren die allgemeine Intelligenz von betroffenen Personen mit der Diagnose „frühkindlicher Autismus“ eher zu überschätzen (vgl. Bölte, Dziobek & Poustka 2009; Fangmeier & Rauh 2015). Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass ihre Intelligenz bisher deutlich unterschätzt wurde und dass der Anteil an autistischen Personen mit unterdurchschnittlicher Intelligenz wesentlich geringer sein dürfte als bisher angenommen wurde (vgl. Courchesne et al. 2015; auch Baron-Cohen et al. 2009).
Merkbox
„Die detailorientierte Wahrnehmung weist besondere Stärken auf, so dass beispielsweise kleinste Gegenstände auf einem Hintergrund erkannt werden können. In der Muster- und Fehlererkennung zeigen Autisten ein großes Talent. (…) Sie können sich unter gegebenen Bedingungen besonders gut auf kleine Details fokussieren und verharren dort konzentriert. Man nennt dies auch Hyperfokus. Hingegen fällt es ihnen schwerer, sich auf das Gesamtbild zu konzentrieren und dieses als solches wahrzunehmen. (…)
Generell werden Reize nach der visuellen Reizaufnahme bzgl. ihrer Merkmale analysiert und zusammengefügt. Bei autistischen Menschen wurden Unterschiede in der Aufmerksamkeit für Reize festgestellt. So orientierten sich Autisten an anderen Hinweisreizen als die meisten Menschen. Autisten zeigten hier jedoch keine verminderte Aufmerksamkeit. Wurde ein visueller Reiz einmal von einem Autisten fokussiert, ließen diese sich schwerer in ihrer Aufmerksamkeit wieder davon losreißen. Teilweise entstand sogar eine Art ‚Tunnelblick‘, wobei sich Autisten auf Teilausschnitte eines Gesamtbilds fokussierten. Autisten lassen sich weniger vom Kontext, als von Einzelreizen beeinflussen. Auch lassen sich somit teilweise die häufig auftretenden Probleme mit der Gesichtserkennung autistischer Menschen erklären. Denn diese fungieren eher detailorientiert und weniger auf das Gesamtbild ausgerichtet. Gesichter werden sozusagen in ihre ‚Bruchstücke‘ zerlegt. Es wird zudem vermutet, dass sich Emotionen von autistischen Menschen deshalb schwieriger von Gesichtern ablesen lassen könnten“ (Groß 2020).
Prävalenz von Lernschwierigkeiten (unterdurchschnittlicher Intelligenz) bei Autismus
Bis vor wenigen Jahren galt Autismus als ein eher seltenes Phänomen. Dies hat sich inzwischen geändert. Die geschätzte Prävalenz von Autismus liegt derzeit bei über einem Prozent (vgl. Miles-Paul 2020). Ferner wird mittlerweile nicht mehr davon ausgegangen, dass etwa 75 % aller autistischen Personen (vor allem mit dem sogenannten „frühkindlichen“ oder „klassischen Autismus“) zugleich unterdurchschnittlich intelligent („geistig behindert“) seien. Wie es zu dieser Behauptung überhaupt gekommen ist und wieso sie sich über mehrere Jahrzehnte unreflektiert halten konnte, bleibt bis heute unklar (vgl. Theunissen & Sagrauske 2019, 18). Nach Edelson (2006) hat es nie einen signifikanten empirischen Beleg für diesen hohen Prozentwert gegeben. Auf der Grundlage ihrer Analyse und neuerer Studien kommt die Forscherin zu dem Schluss, dass die Prävalenzrate von Lernschwierigkeiten bei Autismus „wesentlich geringer sei (…) und zwischen 40 % und 55 %“ liege (ebd., 74). Dieser Wert deckt sich mit einer Untersuchung von Charman et al. (2011).
Derzeit wird auf der Grundlage der Erhebungen aus den letzten Jahren bei etwa 31 % aller nach DSM-5 diagnostizierten autistischen Personen von einem IQ unter 70 und bei etwa 23 % von einem IQ zwischen 71 und 85 ausgegangen (vgl. Brown, Chouinard & Crewther 2017, 3; Jack & Pelphrey 2017, 7). Untersuchungen aus mehreren US-Bundesstaaten (CDC 2012) führen zu einem Mittelwert von 38 % für autistische Schüler*innen im Alter von acht Jahren mit unterdurchschnittlicher Intelligenz. Diesbezüglich befinden sich an dem einen Ende Staaten, bei denen nur etwa 12 % bis 20 % aller erfassten autistischen Kinder zugleich als kognitiv beeinträchtigt gelten; an dem anderen Ende stehen Staaten, bei denen der Anteil an erfassten autistischen Kindern mit zusätzlichen Lernschwierigkeiten bei 50 % bis 65 % liegt.
Diese unterschiedlichen Werte lassen Schwierigkeiten vermuten, die mit der Auswahl geeigneter Testinstrumente sowie mit dem Testen (Motivation, Einhaltung von Zeitvorgaben, Sprachvermögen etc.) betroffener Schüler*innen einhergehen. Alles in allem stützen sie die Annahme, dass die Intelligenz der Betroffenen eher unterschätzt als überschätzt wird.
Prävalenz von Autismus bei Menschen mit Lernschwierigkeiten („Intelligenzminderung“)
Interessant ist gleichfalls die Frage nach der Prävalenz von Autismus bei Menschen mit Lernschwierigkeiten. Derzeit wird ähnlich wie beim Autismus davon ausgegangen, dass hierzulande die Prävalenz in Bezug auf „intellektuelle Entwicklungsstörung“ (geistige Behinderung) bei etwa 1 % liegt (vgl. Theunissen 2021b, 40).
Nach einer von Sappok u. a. (2013, 7) tabellarisch zusammengestellten Übersicht und Auswertung mehrerer Prävalenzstudien aus dem angloamerikanischen Sprachraum besteht „in Abhängigkeit vom verwendeten Untersuchungsinstrument, den Diagnosekriterien und untersuchten Studienpopulationen“ (ebd.) bei 8 % bis 39 % der Menschen mit Lernschwierigkeiten zusätzlich ein Autismus. Dabei scheint die Prävalenz mit dem Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung zu steigen.
Underwood, McCarthy und Tsakanikos (2010) nennen auf der Grundlage verschiedener Forschungsarbeiten einen Wert zwischen 8 % und 20 %; und Bhaumik et al. (2008) ermittelten im Rahmen einer groß angelegten, repräsentativen Untersuchung bei Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten (N=2711) 8,8 %. Auf etwa 8 % kommen gleichfalls King und Bearman (2009, 1233).
Eigene repräsentative Untersuchungen (Kulig & Theunissen 2012, 129; Theunissen 2003, 431) in Deutschland ergaben, dass nach Auskunft von Lehrer*innen in Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie von Mitarbeiter*innen in Wohneinrichtungen der Lebenshilfe 8 % bis 12 % der Personen mit Lernschwierigkeiten zugleich als „autistisch“ eingeschätzt werden können.
Gleichwohl ist es auch bei Frage nach der Prävalenz von Autismus bei Menschen, denen eine „geistig Behinderung“ nachgesagt wird, schwierig, zu verlässlichen Daten zu gelangen. Das zeigt gleichfalls eine aktuelle großangelegte Untersuchung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe in Baden-Württemberg (vgl. Theunissen u. a. 2018; Theunissen & Kulig 2019). Nach Befragung von leitenden Mitarbeiter*innen hatten 25 % der 433 erfassten Erwachsenen mit (schwerwiegendem) herausforderndem Verhalten aus den Sondergruppen und 16 % der 185 erfassten Erwachsenen mit herausforderndem Verhalten aus dem Regelwohnen eine Autismus-Diagnose (v. a. „frühkindlicher Autismus“); und 12 % der Personen aus den Sondergruppen sowie 18 % aus dem Regelwohnen wurden zusätzlich zu einer kognitiven Beeinträchtigung und zu Verhaltensauffälligkeiten „autistische Züge“ (z. B. nur repetitives oder stereotypes Verhalten; stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Routine) attestiert. An dieser Stelle schimmern Vorstellungen und Zuschreibungen durch, „die nicht zu dem passen, was ‚Autismus‘ im Kern ausmacht“ (Schmidt 2020, 231), wohl aber eine Normabweichung signalisieren, die von befragten Personen als eine pädagogisch-therapeutische Herausforderung betrachtet wird.
Читать дальше