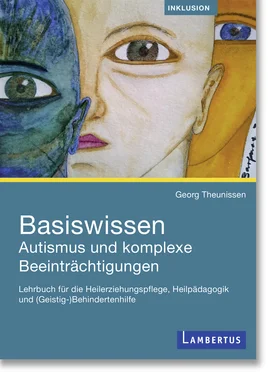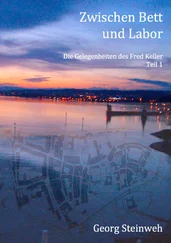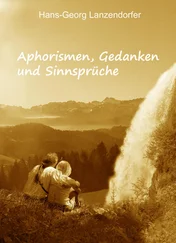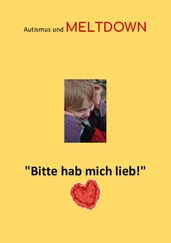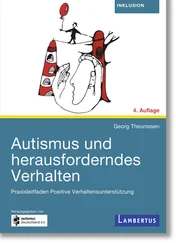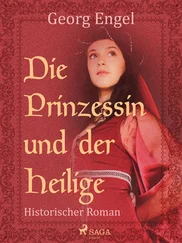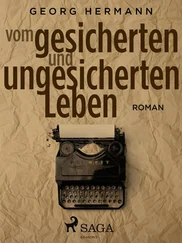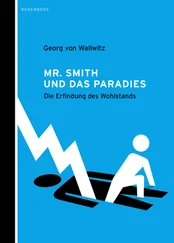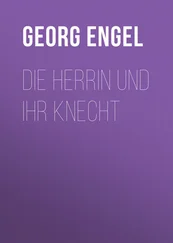Bezüglich der klinischen Bilder wird gerne im Bereich der (Geistig-)Behindertenhilfe auf das Konzept der Verhaltensphänotypen verwiesen.
Darunter versteht K. Sarimski (1997, 15) „eine Kombination von bestimmten Entwicklungs- und Verhaltensmerkmalen, die bei Kindern und Erwachsenen mit einem definierten genetischen Syndrom mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auftritt als bei Kindern und Erwachsenen mit einer Behinderung anderer Ursache.“ Hierbei sind allerdings individuelle Unterschiede zu beachten: Nicht alle Kinder mit Fragilem-X-Syndrom entwickeln in gleichem Maße autistisches oder selbstverletzendes Verhalten, nicht alle Kinder mit tuberöser Sklerose entwickeln eine komplexe Behinderung mit einer gesteigerten Anfallsbereitschaft (vgl. Neuhäuser 2004). In diesem Sinne warnt Sarimski (2013, 404) zurecht vor „einer unzulässigen Verallgemeinerung , dass alle Kinder mit einem bestimmten Syndrom die jeweiligen Verhaltensformen in gleicher Ausprägung entwickeln.“ Außerdem verleitet das Konzept der Verhaltensphänotypen zu einer defizit- oder störungsorientierten Betrachtung des Verhaltens. Demgegenüber sollten wir in Betracht ziehen, dass es bezüglich der verschiedenen klinischen Bilder nicht nur Verhaltensauffälligkeiten, sondern ebenso verhaltensphänotypische Stärken oder Fähigkeiten gibt. Diesem „ganzheitlichen“ Aspekt haben wir bei unserer stichwortartigen Übersicht der Bilder (siehe Anhang) Rechnung zu tragen versucht. Denn die bloße defizit- oder störungsspezifische Betrachtung eines klinischen Bildes ist pädagogisch gesehen eine Sackgasse. Darüber hinaus ist bei der Interpretation der Ähnlichkeiten zwischen Autismus bzw. autistischem Verhalten und den Verhaltensphänotypen bestimmter genetisch bedingter Syndrome Vorsicht geboten (Moss & Howlin 2009). Das gilt für eine vorschnelle Verwendung des Begriffs „autistisch“ oder Annahme eines Autismus. Greifen wir dazu das folgende Beispiel auf:
Ein Beispiel aus der Praxis
Es geht um Mathew, der das Williams-Syndrom und (ungewöhnlich für dieses klinische Bild) schwerste kognitive Beeinträchtigungen hat. „Seine begrenzten Kommunikationsfähigkeiten, seine mangelnde Soziabilität und sein stark stereotypes Verhalten führten dazu, dass er die zusätzliche Diagnose ‚Autismus-Spektrum-Störung‘ erhielt – dies ungeachtet der Tatsache, dass diese Schwierigkeiten aufgrund seines sehr niedrigen IQ erklärbar waren“ (ebd. 18).
Gleichwohl kann das Erkennen von autistischen Merkmalen oder atypischen bzw. autismusähnlichen Verhaltensweisen hilfreich sein, um eine betroffene Person besser zu verstehen und ihr eine passgenaue Unterstützung (Assistenz) anbieten zu können. Auch hierzu ein Beispiel (zit. n. ebd., 18):
Ein Beispiel aus der Praxis
Jake, ein 8-jähriger Junge mit Down-Syndrom zeigt ein typisches Autismus-Profil mit repetitiver, nicht-kommunikativer Sprache, schlechtem Blickkontakt, begrenzter Interaktion mit anderen Menschen und einer Vielzahl von repetitiven und eingeschränkten Interessen. Obwohl seine Eltern sich zunehmend Sorgen über seine mangelnden Fortschritte gemacht hatten, interpretierten die Schulangehörigen sein Verhalten als ‚schwierig‘ oder ‚ungezogen‘ und lehnten die Möglichkeit einer komorbiden Autismus-Spektrum-Störung erneut ab. Mit der Zeit wurde Jakes Verhalten immer störender und aggressiver. Die diagnostische Beurteilung ergab, dass er alle Kriterien in Bezug auf Autismus-Spektrum-Störung erfüllte. Daraufhin wurde ein Unterstützungsprogramm durch einen spezialisierten Dienstleister für Autismus empfohlen.
Ein solches Beispiel veranschaulicht, dass das Verkennen des Autismus, autistischer Merkmale oder Verhaltensweisen ungünstige Auswirkungen auf die Entwicklungschancen einer Person mit einen bestimmten klinischen Bild haben kann. Was die Unterstützungsformen betrifft, so gibt es bis heute keine Unterschiede zwischen Angeboten für Personen mit syndromalem Autismus oder idiopathischem. Das Problem besteht eher darin, „dass Kinder mit genetischen Syndromen möglicherweise erst viel später eine Differentialdiagnose ‚Autismus-Spektrum-Störung‘ erhalten als andere autistische Kinder“ (ebd.).
Treten verhaltensphänotypische Verhaltensauffälligkeiten auf, sollte die Umgebung so gestaltet werden, dass möglichst dem Problemverhalten vorgebeugt werden kann. Dazu sind Bedingungen zu analysieren, unter denen eine betroffene Person zu einem auffälligen (z. B. selbstverletzenden, hyperaktiven, fremdaggressiven) Verhalten neigt, hypersensibel reagiert, Ängste entwickelt oder in Stress gerät. Ebenso sind Stärken und Interessen sowie Situationen zu erfassen, in denen eine Person für eine Ressourcenaktivierung besonders zugänglich ist.

Pädagogischer Hinweis
„Das Konzept der ‚Positiven Verhaltensunterstützung‘ sieht eine solche sorgfältige Analyse der Auftretenszusammenhänge und Funktionen von auffälligen emotionalen Reaktionen oder sozialen Verhaltensformen vor. Daraus wird dann abgeleitet, wie Situationen angepasst werden können, um Überforderung zu vermeiden bzw. welche Fertigkeiten gezielt zu ihrer Bewältigung eingeübt werden können. Dazu gehört z. B. die Visualisierung von Tagesstrukturen bei Kindern, für die Übergänge von einer Tätigkeit zur anderen besonders kritisch sind, der Aufbau von selbstständiger Beschäftigung und lebenspraktischen Fertigkeiten für Kinder, die sehr wenig spielen können, oder die Anbahnung einfacher Gesten bzw. der Gebrauch von elektronischen Kommunikationshilfen, um Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen, für Kinder, die noch nicht sprechen können. Das Ziel dieser Interventionen ist nicht eine bloße Reduzierung von auffälligen Symptomen, sondern die Verbesserung der Beziehungen des Kindes zu seiner Umwelt“ (Sarimski 2012, 107).
Bei 75 % bis 90 % aller diagnostizierten Autist*innen haben wir es mit einem ideopathischen Autismus zu tun, bei dem die genauen genetischen Ursachen noch unklar sind bzw. keine unmittelbare Ursache festgestellt werden kann. Auf jeden Fall ist ein genetischer Hintergrund in Bezug auf die Entstehung von Autismus bedeutsam. Das schimmert bereits bei den Erstbeschreibungen über Autismus durch. Im Hinblick auf genetische Einflüsse wird auf Familien- und Zwillingsstudien verwiesen. So finden sich z. B. Hinweise für eine familiäre Häufung von Autismus oder autistischer Verhaltensweisen. Familienstudien zufolge weisen viele Verwandte ersten Grades Verhaltensweisen auf, die in sozialer und kommunikativer Hinsicht autistisch wirken, aber nicht dem „Vollbild“ des Autismus-Spektrums entsprechen. Die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung autistischen Verhaltens ist bei Geschwistern eines autistischen Geschwisterkindes um etwa 60 % höher als in der Allgemeinbevölkerung. Zwillingsstudien weisen mit etwa 77 % eine hohe Autismus-Konkordanzrate (Übereinstimmung) bei männlichen eineiigen Zwillingen auf. Insofern entwickelt nicht jeder eineiige Zwilling ein autistisches Verhalten. Ferner scheint der Ausprägungsgrad der Behinderung bei eineiigen Geschwistern aus dem Autismus-Spektrum erheblich zu variieren. Das bedeutet, dass nicht von einer eindeutigen genetischen Verursachung von Autismus ausgegangen werden kann. Vielmehr spielt das Zusammenwirken von Genmutationen oder einer Vielfalt an Risikogenen mit Umweltfaktoren im Hinblick auf die Entstehung von Autismus bzw. die Expression autistischer Merkmale die entscheidende Rolle. Genaue Zusammenhänge sind jedoch bis heute unklar.
Neuere Studien gehen davon aus, dass epigenetische Prozesse das Zusammenspiel zwischen genetischen Faktoren mit Umweltkomponenten hintergründig beeinflussen. Bezüglich der externen Faktoren ist festgestellt worden, dass demografische Aspekte (hohes Alter der Mütter oder Väter) 7, mütterliche Erkrankungen (Infektionen, Vergiftungen, schwere psychische Störungen) oder Medikamenteneinnahme (Valproat, Barbiturate) während der Schwangerschaft, prä- und perinataler Stress, ein überdurchschnittlich hoher intrauteriner Testosteronspiegel 8, Geburtskomplikationen oder kurzer Geburtsabstand (zweitgeborenes Kind unter einem Jahr nach Geburt des zuvor geborenen Geschwisterkindes) einen Autismus begünstigen können.
Читать дальше