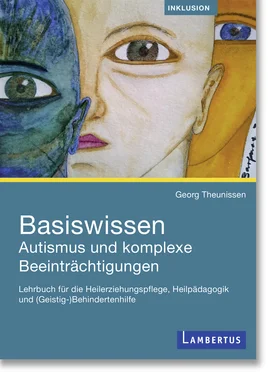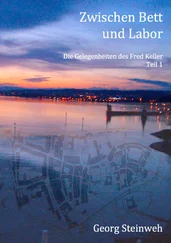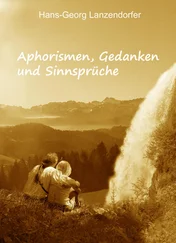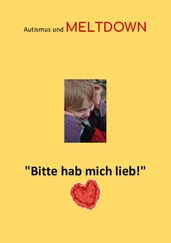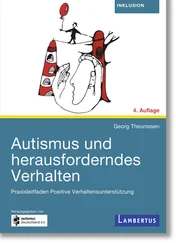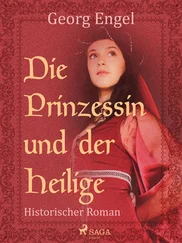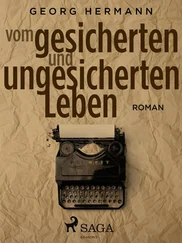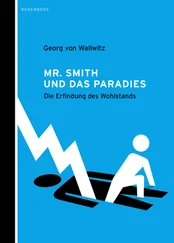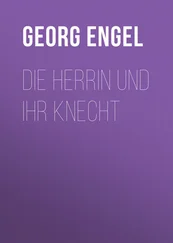1 ...6 7 8 10 11 12 ...19
Komplexe Beeinträchtigungen
Wie im Vorwort bereits erwähnt, ist es unser Anliegen, Erkenntnisse, die besondere Situation sowie den Unterstützungsbedarf autistischer Menschen aufzugreifen, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich als „ empowered persons “ selbst zu vertreten oder von denen nur wenige in der Lage sind, als „Expert*innen in eigener Sache“ für sich selbst zu sprechen. Das betrifft Autist*innen mit „komplexen Beeinträchtigungen“. Gemeint sind damit in erster Linie Personen, denen zusätzlich zu ihrem Autismus hierzulande eine „geistige Behinderung“, international eine „ intellectual disability “ oder (insbesondere in Nordamerika) eine „ developmental disability “ nachgesagt wird. Darüber hinaus gibt es noch weitere Parallelbezeichnungen, die sich nicht selten auf mehrfache Behinderungen oder eine Komplexität an Beeinträchtigungen beziehen, die das Zusammenwirken biologischer (hirnorganischer) Ursachen, externer (sozialer) Einflussfaktoren sowie das subjektive Erleben betreffen. Die Fülle unterschiedlicher Parallelbegriffe resultiert hierbei nicht nur aus der wissenschaftlichen Debatte, sondern ist ebenso ein Ergebnis der Diskussion im Lager der Selbstvertretungsgruppen (Betroffenen), die den Begriff der „geistigen Behinderung“ als diskriminierend erleben und ihn daher durch „Lernschwierigkeiten“ ersetzt haben. Diese Begriffsvielfalt und Diskussion soll im Folgenden kurz aufgegriffen und reflektiert werden.
Zum Begriff der „geistigen Behinderung“
Seit der Einführung durch die Elternvereinigung „Lebenshilfe“ in den späten 1950er Jahren ist die Bezeichnung „geistige Behinderung“ ein gesellschaftlich weit verbreiteter Fach- und Leitbegriff im deutschsprachigen Raum. Ziel war es, damalige Bezeichnungen wie „Schwachsinn“, „Oligophrenie“ „Idiotie“ oder „Blödsinn“ durch einen weniger stigmatisierenden Begriff abzulösen (vgl. dazu Theunissen 2021b).
Inzwischen steht jedoch auch „geistige Behinderung” als Fach- und Leitbegriff in der Kritik. So können wir seit den 1990er Jahren immer mehr Stimmen verzeichnen, die auf den diskriminierenden Charakter des Begriffs sowie auf stigmatisierende Zuschreibungen verweisen und daher für seine Abschaffung plädieren. Im schulischen Bereich wurde darauf reagiert, indem offiziell statt „geistige Behinderung” die Bezeichnung „ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung “ eingeführt wurde. Diese bezieht sich sowohl auf die betreffenden Schüler*innen als auch auf das Erziehungs- und Bildungssystem.
Aus der fachwissenschaftlichen Debatte gibt es den Vorschlag, von „ komplexer Behinderung “ zu sprechen, da Menschen, die bisher als „geistig behindert” bezeichnet werden, zumeist in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt sind (kognitiv, motorisch, sensorisch) und insbesondere unter sozialen Erfahrungen leiden, von ihrer Umwelt diskriminiert, ausgegrenzt und benachteiligt, vor allem in ihren Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten durch sprachliche und strukturelle Barrieren behindert zu werden (vgl. Fornefeld 2008; Theunissen 2021b).
International gab es seit den 1950er Jahren die Bezeichnungen „ mental retardation “ oder „ mental handicap “, die vor geraumer Zeit gleichfalls als diskriminierend erkannt und von der klinischen Fachwelt durch den Begriff der „ intellectual disability “ ersetzt wurden. Während sich diese neue Bezeichnung international durchsetzen konnte, gilt dies nicht für die Übersetzung „intellektuelle Behinderung” (Weber 1997) im deutschsprachigen Raum.
Da Betroffene, die sich weltweit unter dem Organisationsnamen People First in Selbstvertretungsgruppen zusammengeschlossen haben, sowohl die alten Bezeichnungen als auch die Neuerung durch „ intellectual disability ” als diskriminierend erleben, geben sie Begriffen wie „ developmental disability ” oder „ learning difficulties ” den Vorzug.
In Nordamerika haben Fachwelt und Politik „ developmental disability ” als Oberbegriff für organisch bedingte „geistige Behinderung”, für Autismus und für schwerste mehrfache Behinderungen eingeführt; und in Großbritannien wurde mit Blick auf die Betroffeneninitiative neben „ intellectual disability ” der Begriff „ learning disabilities “ zugelassen (vgl. Ramcharan 2002).
Hierzulande plädieren Vertreter*innen der Selbsthilfevereinigung People First für „ Lernschwierigkeiten “ als direkte Übersetzung des englischen Begriffes „ learning difficulties “. In Anbetracht der Einengung auf Lernprozesse sowie der Abgrenzungsschwierigkeit zum deutschsprachigen Begriff der „Lernbehinderung” hat sich dieser Vorschlag in der Fachwelt und Politik nicht durchsetzen können (vgl. Theunissen 2021b).
Gleichwohl gibt es aus der Empowerment-Perspektive (vgl. Theunissen 2013) Sympathien für die Bezeichnung „Lernschwierigkeiten”, weil sie von Betroffenen stammt, wohl den geringsten Stigmatisierungseffekt hat und es letztlich keinen Grund dafür gibt, einen aus der Fachwelt favorisierten Begriff zu nutzen, der selbstkritisch als unzulänglich und normativ betrachtet wird. Das damit verknüpfte Argument, „geistige Behinderung” der Verständigung halber weiter zu nutzen solange es keinen tragfähigen Alternativbegriff gebe, überzeugt uns nicht.
Alles in allem führt uns die bisherige Diskussion über den geeigneten Begriff zu dem Schluss, Bezeichnungen wie „Lernschwierigkeiten” gegenüber „geistige Behinderung” den Vorzug zu geben und insbesondere beim Vorliegen einer schweren intellektuellen Entwicklungsstörung (Intelligenzminderung) und bei „mehrfachen Behinderungen” unter „ komplexe Beeinträchtigungen ” zu subsumieren. Zugleich sollen unter der Komplexität aber auch soziale Behinderungserfahrungen und psychosoziale Probleme oder psychische Begleitstörungen mitgedacht werden, die nicht selten einen Leidensdruck und gesellschaftliche Benachteiligung erzeugen.
Abschließend sei erwähnt, dass die Suche nach einem geeigneten neuen Fachbegriff die Weltgesundheitsorganisation dazu veranlasst hat, in ihrem soeben auf den Weg gebrachten Klassifikationssystem ICD-11 die Bezeichnung „intellektuelle Entwicklungsstörung“ ( disorders of intellectual development ) für klinische Bilder (Symptome und Syndrome) zu benutzen, die sich bisher auf „Intelligenzminderung” bezogen (vgl. Sappok; Georgescu & Weber 2019). Ähnlich verfährt das US-amerikanische Klassifikationssystem DSM-5, welches den Begriff „ intellectual disability” verwendet und in Klammer „intellectual developmental disorder” ergänzt hat, wodurch eine Verbindungslinie zur ICD-11 hergestellt wurde (vgl. APA 2013).
Zur Klassifikation von „Intellektueller Entwicklungsstörung/Intelligenzminderung” nach DSM-5 und ICD-10/ ICD-11
Im DSM-5 wird „intellectual disability (intellectual developmental disorder)“ unter drei zentralen Gesichtspunkten aufbereitet:
1. Im Hinblick auf Defizite in der „intellektuellen Funktionsfähigkeit“ (intellectual functioning)
Das betrifft vor allem logisches, problemlösendes und abstraktes Denken, Planen, Urteilen, akademisches und experimentelles Lernen, Lernen aus Erfahrung oder Beobachtung. Zur Erfassung der „intellektuellen Funktionsfähigkeit“ werden neben einem klinischen Assessment und Intelligenztests gleichfalls soziale Einflussfaktoren (sozio-kultureller Hintergrund, Muttersprache) sowie zusätzliche kommunikative, motorische oder sensorische Beeinträchtigungen mit in Betracht gezogen.
2. Im Hinblick auf Defizite in der „adaptiven Funktionsfähigkeit“ (adaptive functioning)
Читать дальше