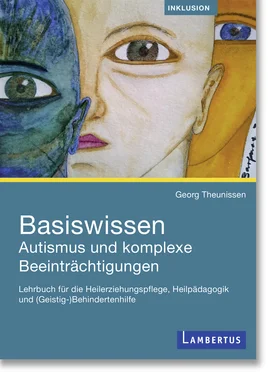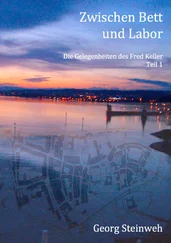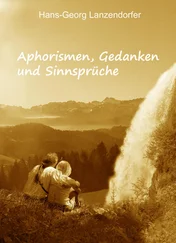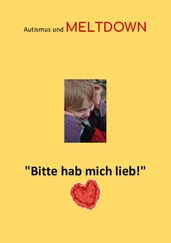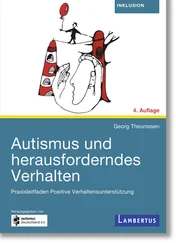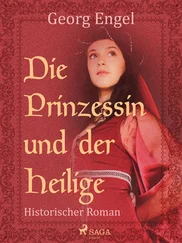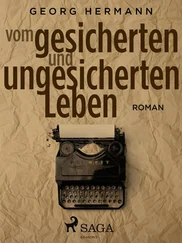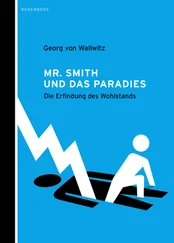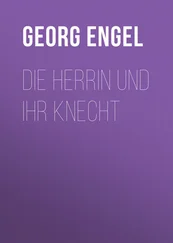Pädagogischer Hinweis
Zeitliche und inhaltsbezogene Strukturierungspläne sollten mit Alternativen versehen werden, z. B. Plan A, Plan B, Plan C. Dadurch können einige unvorhergesehene Situationen vermieden oder plötzlich notwendige Programmänderungen erfasst werden. Hilfreich für Situationswechsel ist zudem der Einsatz eines Timetimers.
(6) Schwierigkeiten, Sprache zu verstehen und sich sprachlich auszudrücken, so wie es üblicherweise in Kommunikationssituationen (Gesprächen) erwartet wird
Diese Schwierigkeiten beziehen sich sowohl auf die verbale als auch die non-verbale Kommunikation, das Sprachverständnis und den -ausdruck. Dazu gehört unter anderem das „Wörtlichnehmen“ sprachlicher Ausdrücke, zu denen auch bestimmte Redewendungen oder Sprichwörter zählen, Verzögerungen in der Sprachentwicklung oder Besonderheiten und spezielle Phänomene wie Hyperlexie (siehe Kapitel II), Echolalie, Neologismen (kreative Wortneubildungen) oder eine auffällige Intonation.
Sehr häufig ist zu beobachten, dass autistische Personen während eines Gesprächs keinen Blickkontakt zeigen. Grund dafür ist vermutlich die Komplexität der non-verbalen Mitteilungen durch Mimik und Gestik, die die inhaltlichen (verbalen) Informationen im Gespräch begleiten und für viele Autist*innen eine Reizüberflutung darstellen. Der fehlende Blickkontakt kann somit eine Strategie sein, um Stress durch Reizüberflutung zu vermeiden und die Konzentration auf die verbale Kommunikation zu erhöhen.
Es ist zu beachten, dass Schwierigkeiten in der Kommunikation immer von beiden Gesprächspartner*innen ausgehen können. Oftmals werden von nicht-autistischen Menschen uneindeutige Botschaften vermittelt, die dem Gegenüber ein hohes Maß an intuitivem Vorwissen und Interpretationsfähigkeiten („zwischen den Zeilen zu lesen“) abverlangen. Gerade dies fällt autistischen Personen, bei denen wahrnehmungsbezogenes Denken dominiert, besonders schwer.

Pädagogischer Hinweis
Wenn mit autistischen Menschen sprachlich kommuniziert wird, sind kurze Sätze und möglichst eindeutige Inhalte (Worte) sehr hilfreich. Zweideutige oder unklare Informationen, die eine intuitive Erschließung abverlangen („Kannst Du Dir die Nase putzen“), sollten vermieden werden. Weitere Anregungen für die Praxis enthält das Kapitel über Hyperlexie.
(7) Schwierigkeiten, typische soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren
Schwierigkeiten, soziale Interaktionen zu erfassen, aufrechtzuerhalten oder aufzubauen gelten als ein deutliches Merkmal für Autismus. Dazu zählt die damit verknüpfte Schwierigkeit der Perspektivübernahme, sozialen Empathie und Antizipation. Für Peter Schmidt (2020, 26 f.) geht es hierbei um die Muster der „Kommunikation ohne Beziehungsebene“ und des „Sozialverhaltens ohne gegenseitige Empathie“, die Autismus charakterisieren. Hintergründig spielen die Selbstbezogenheit autistischer Personen und zugleich ein fehlendes Interesse „für die Alltagsbelange anderer Menschen“ (ebd., 27) eine wichtige Rolle. Zudem werden soziale Verhaltensbesonderheiten autistischer Personen oft von sensorischen Hypersensitivitäten moderiert (z. B. sozialer Rückzug und „Selbstisolation“ als Strategie vor Reizüberlastung).
Allerdings mangelt es nicht bei allen autistischen Personen an Einfühlungsvermögen, zudem können manche ihre Schwierigkeiten der Perspektivübernahme durch kognitive Fähigkeiten ausgleichen (vgl. Schmitt-Lemberger 2020, 98 ff.). Zudem gibt es Autist*innen, die anderen Menschen vorurteilsfrei begegnen, ihre „unmaskierten“ Gefühlslagen sowie soziale Interaktionen sensibel erfassen können. So berichtet zum Beispiel G. Schmitt-Lemberger (2020, 34) über ihren nicht-sprechenden, schwer autistischen Sohn, dass er ein feines Gespür dafür hat, wenn etwas beim anderen nicht stimmt. Für die Autistin Gee Vero (2020, 26) nutzen autistische Menschen hierbei „eine Art Wunderwerkzeug, nämlich das Sensing “. Dies ist eine „allen Menschen angeborene Fähigkeit (…), eine Art des Spürens, also des Erfühlens der inneren Zustände eines anderen Menschen“ (ebd.). Vermutlich ist es bei vielen nicht-autistischen Menschen, die vorrangig sprachbezogen denken und sprachlich kommunizieren, im Laufe ihres Lebens zu einer Verkümmerung dieser Fähigkeit gekommen. Bei einigen autistischen Personen, die wahrnehmungsbezogen denken, scheint sie hingegen unabhängig ihrer Intelligenz weiterhin wirksam zu sein. „Elijah (ihr schwerst autistischer und kognitiv beeinträchtigter Sohn, d. A.) und ich brauchen eigentlich keine verbale Sprache, da das Sensing zwischen uns wunderbar funktioniert. Ich erspüre viel von dem, was er braucht, wie es ihm geht und was ihm eventuell helfen könnte. Elijah merkt auch als Erster, wenn es mir nicht gut geht und reagiert dann entsprechend darauf“ (ebd., 27). Mit Hilfe des Sensing können Autist*innen leicht hinter die Maske schauen, die sich nicht-autistische Personen im Zuge ihrer Ich-Entwicklung zugelegt haben. Diese „soziale Intuition“ (Seng 2019) greift auch Iris Johansson (2019, 60) auf, wo sie auf ihre Beobachtungsfähigkeit und ihr Gefühl verweist, andere Personen zu „durchschauen“ und das anzusprechen, was sich hinter ihrer „Verhaltensfassade“ verbirgt. Eine solche Begabung ist schon H. Asperger (1944, 117) aufgefallen, der sich die Frage stellte, wie eine autistische Person in Anbetracht ihrer Selbstbezogenheit überhaupt ein „erstaunlich richtiges und reifes Urteil über die Menschen der Umgebung“ abgeben kann. Eine Auflösung dieses „scheinbaren“ Widerspruchs sah er in der Fähigkeit zur Distanzierung, nämlich „mit Klarsicht“ oder auf „analytische Weise“ (Seng 2019, 212) Dinge, Menschen oder soziale Interaktionen zu betrachten. Diese Fähigkeit schrieb er nur autistischen Menschen zu.
Freilich fällt es ebenso manchen autistischen Personen schwer, Stimmungen, Absichten oder Hintergedanken nicht-autistischer Menschen zu erfassen und zu verstehen (vgl. Sonja in: Kohl, Seng & Gatti 2017, 229). So hat zum Beispiel G. Schmitt-Lembergers Sohn Schwierigkeiten, die von ihm erspürten Stimmungen zuzuordnen. „Er ist dann verunsichert, unausgeglichen und er verhält sich ‚unangemessen‘, vielleicht einfach auch nur, um zu zeigen, dass es ihm damit gerade überhaupt nicht gut geht. (…) Wenn das bei uns so ist, weiß ich mittlerweile, dass mein Kind mein ’Spiegel‘ ist. Er spiegelt mir, dass etwas gerade gar nicht gut läuft. Das hält mich dazu an, innezuhalten, die Situation zu reflektieren, Dinge in Ordnung zu bringen und vor allem, ihm seine Sicherheit zurückzugeben!!!“ (ebd. 2020, 34).

Pädagogischer Hinweis
Soziale Verhaltensbesonderheiten autistischer Personen bedürfen einer differenzierten Betrachtung. Um sie zu verstehen, sollte eine sicherheitsstiftende Vertrauensbasis und Bezugsassistenz hergestellt werden.
Zum Aufbau einer positiven Beziehung bietet sich insbesondere bei schwer zugänglichen autistischen Personen die Technik des Spiegelns von Verhalten an. Hat sich ein positives kommunikatives Verhältnis entwickelt, können auf dieser Basis soziale Lernprozesse und u.a. (motivierende) Aktivitäten für die Gemeinschaft in den Blick genommen werden, dies zunächst behutsam über ein gemeinsames Tun, dann schrittweise durch Abbau des jeweils letzten Handlungsschritts des gemeinsamen Tuns, sodass die autistische Person nach und nach einzelne Handlungsschritte und schließlich die gesamte Tätigkeit selbstständig ausführt.
Читать дальше