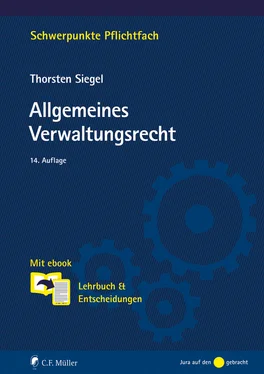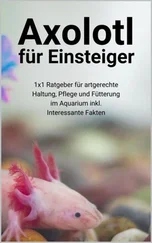915
Der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch kommt in verschiedenen Konstellationen in Betracht. Anspruchsgegnerist im Normalfall der Bürger. Allerdings kann auch umgekehrt der Bürger einen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch gegen die öffentliche Verwaltung haben[2]. Öffentlich-rechtliche Erstattungsansprüche können schließlich auch zwischen zwei Verwaltungsträgern bestehen[3].
Beispiel:
Die Stadt X und B schließen einen Vertrag, der ein Baurecht für B, einen Dispens für die Anlegung von Stellplätzen sowie die Zahlung eines bestimmten Betrags durch B an X zum Gegenstand hat. Nach dem Leistungsaustausch stellt sich heraus, dass B schon zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geschäftsunfähig war.
916
Der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch ist bislang nur teilweise kodifiziert worden, insbes. in § 49a (s.u. III.)[4]. Der in anderen Konstellationen einschlägige allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch (s.u. IV.) hat jedoch bislang keine explizite Regelung erfahren. Wegen der Parallelen zum Recht der ungerechtfertigten Bereicherung wurde er lange Zeit mit einer analogen Anwendung der §§ 812 ff BGB begründet[5]. Ganz überwiegend wird er jedoch inzwischen als eigenständiges Rechtsinstitut des öffentlichen Rechtsanerkannt[6]. Das zentrale Begründungselement bildet der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung[7], bei Erstattungsansprüchen des Bürgers ergänzt durch die Grundrechte[8]. Oftmals wird sogar schon eine gewohnheitsrechtliche Verfestigung angenommen[9]. Trotz der unterschiedlichen Begründungsansätze gleichen sich die gewonnenen Ergebnisse weitestgehend. Die Diskussion hat daher kaum praktische Konsequenzen. Allerdings hat die Anerkennung als eigenständiges Institut des öffentlichen Rechts im Vergleich zur analogen Anwendung der §§ 812 ff BGB Auswirkungen auf die Begründungslast: Denn sie ermöglicht die positive Begründung der Anspruchsmerkmale, während bei der analogen Anwendung der §§ 812 ff BGB umgekehrt begründet werden muss, warum einzelne Teilregelungen des BGB nicht zur Anwendung kommen. Dies wird etwa relevant beim Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB (s.u. Rn 926).
III. Der Erstattungsanspruch nach § 49a VwVfG
917
§ 49a enthält eine Positivierung des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs der öffentlichen Hand. In diesem Bereich gilt der gesetzlich geregelte öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch abschließend– m.a.W.: der allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch findet hier keine Anwendung. Ferner ist § 49a auf nicht erfasste Fälle nicht analoganwendbar; es gibt den allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch, damit fehlt es an einer Regelungslücke[10]. Er soll nach der Rechtsprechung des BVerwG allerdings analog anwendbar sein, wenn ein vorläufiger VA (zum Begriff s.o. Rn 378 f) rückwirkend durch einen anderen VA ersetzt worden ist (Schlussbescheid), der eine geringere Summe festsetzt[11]. Die besseren Gründe sprechen aber auch hier für einen Rückgriff auf den allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch[12]. Hauptanwendungsfalldes § 49a ist die fehlgeschlagene Subvention[13].
2. Die Tatbestandsmerkmale des § 49a Abs. 1 VwVfG
918
Die Norm hat drei Tatbestandsvoraussetzungen:
| • |
Es muss eine Leistung erbracht worden sein, |
| • |
die Leistung muss auf der Grundlage eines VA erbracht worden sein, |
| • |
der VA muss mit Wirkung für die Vergangenheit unwirksam geworden sein – sei es durch Rücknahme, durch Widerruf oder durch Eintritt einer auflösenden Bedingung. |
919
Von besonderer Bedeutung ist, dass die Aufhebung mit Wirkung für die Vergangenheiterfolgt sein muss. Denn eine Aufhebung lediglich mit Wirkung für die Zukunft hätte zur Folge, dass der rechtliche Grund für die Vermögensverschiebung bestehen bliebe. Auch deshalb ist es wichtig, dass ein geldwerter VA nach § 49 Abs. 3 widerrufen wird; denn § 49 Abs. 2 ermöglicht lediglich einen Widerruf mit Wirkung für die Zukunft (s.o. Rn 644)[14].
920
Für den Umfang der Erstattung verweist § 49a Abs. 2 S. 1 auf die Vorschriften des BGB über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Da der Tatbestand allerdings bereits in § 49a Abs. 1 S. 1 geregelt ist, handelt es sich um eine Rechtsfolgenverweisung. Grundsätzlich ist das durch die Leistung auf Grund des VA Erlangte zu erstatten; nach § 818 BGB zusätzlich Nutzungen und Surrogate. Deshalb sind erlangte Zinsenzu erstatten. Der Anspruch ist mit 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen, § 49a Abs. 3[15]; Zwischenzinsen können nach § 49a Abs. 4 gefordert werden.
921
Nicht erfasst von der Verweisung wird die Bestimmung des § 814 BGB(Leistung in Kenntnis der Nichtschuld); denn dabei handelt es sich nicht um eine Regelung zum Umfang der Erstattung, sondern um einen Anspruchsausschluss dem Grunde nach[16]. Hingegen kann sich der Anspruchsgegner grundsätzlich auf den Wegfall der Bereicherungnach § 818 Abs. 3 BGB berufen. Allerdings enthält § 49a Abs. 2 S. 2 eine Sonderregelung zu § 819 BGB: Während nach § 819 Abs. 1 BGB der Entreicherungseinwand lediglich bei positiver Kenntnis ausscheidet, schadet nach § 49a Abs. 2 S. 2 bereits grobe Fahrlässigkeit[17]. Vor dem Hintergrund des Effektivitätsprinzips (s.o. Rn 53) kommt hingegen bei unionsrechtlichbegründeten Ansprüchen lediglich bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände eine Anspruchsbegrenzung in Betracht[18].
4. Durchsetzung des Anspruchs
922
Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen vor, entsteht der Rückforderungsanspruch unmittelbar kraft Gesetzes. Er ist nach § 49a Abs. 1 S. 2 durch VA festzusetzen; diese Vorschrift enthält damit eine explizite VA-Befugnis(zu dieser s.o. Rn 469). Damit hat sich der Gesetzgeber insoweit der sog. „Kehrseitentheorie“ angeschlossen, wonach die Rückforderung die Rechtsnatur des Gewährungsakts teilt (zur abweichenden Rechtslage beim allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch s.u. Rn 927)[19]. Diese Ermächtigung ist jedoch beschränkt auf den Empfänger der Vermögensverschiebung; er erstreckt sich nicht auf Dritte wie nachhaftende ehemalige Gesellschafter[20]. In Betracht kommt auch eine Verpflichtung seines Rechtsnachfolgers. Unzulässig ist hingegen eine Inanspruchnahme des Abtretungsempfängers. Aus der Formulierung „ist festzusetzen“ folgt, dass die Behörde kein Ermessenbesitzt; zulässig ist allerdings eine Stundung[21].
Der Anspruch verjährtin analoger Anwendung der neuen Regelverjährungsfrist des § 195 BGB innerhalb von drei Jahren[22]. Die Frist beginnt gemäß § 199 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem die Behörde von den anspruchsbegründenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste[23]. – Bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist der Erstattungsanspruch bereits dann iSd § 38 InsO begründet, wenn zum Zeitpunkt der Eröffnung ein Widerrufsgrund vorlag. Es kommt insoweit also nicht auf die Ausübung des Widerrufs an[24].
IV. Der allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch
923
Der allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch setzt zunächst eine Rechtsbeziehung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechtsvoraus. Anderenfalls, also bei einer privatrechtlichen Beziehung, kommen hingegen die Bestimmungen zur ungerechtfertigten Bereicherung nach §§ 812 ff BGB zur unmittelbaren Anwendung. Nach der sog. Kehrseitentheorie teilt der Erstattungsanspruch als Rückabwicklung einer Maßnahme die Rechtsnatur ihrer Vornahme[25]. Darüber hinaus verbleibt für den allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch lediglich in solchen Konstellationen Raum, in denen nicht bereits der in § 49a Abs. 1 S. 1 kodifizierte Erstattungsanspruch eingreift (s.o. Rn 917 ff).
Читать дальше