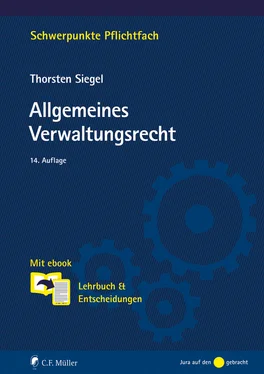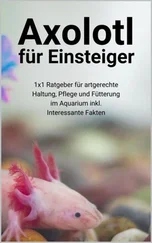3. Grenzen der Privatisierung
891
Allerdings unterliegt die Privatisierung auch gewissen Grenzen. So dürfen staatliche Kernaufgaben, insbes. im Bereich der Eingriffsverwaltung[39], nicht privatisiert werden. Zudem kann auch die kommunale Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG einer Privatisierung Grenzen setzen. Dies hat das BVerwG anhand eines kulturell, sozial und traditionsmäßig bedeutsamen Weihnachtsmarkts, der bisher in alleiniger kommunaler Verantwortung betrieben wurde, entschieden[40]. Abgesehen von diesen allgemeinen Grenzen sind auch bereichsspezifische Grenzenanzutreffen. So setzt etwa Art. 87e GG einer Privatisierung der Deutschen Bahn AG gewisse Grenzen[41].
Ausbildungsliteratur:
Ebeling/Tellenbröcker, Subventionsrecht als Verwaltungsrecht, JuS 2014, 217; Ehlers, Rechtsprobleme der Nutzung kommunaler öffentlicher Einrichtungen, JURA 2012, 692 und 849; Geis/Madeja, Kommunales Wirtschafts- und Finanzrecht – Teil I, JA 2013, 248; Korte, Grundlagen des Subventionsrechts, JURA 2017, 656 ff; Kramer/Bayer/Fiebig/Freudenreich, Die immer noch bedeutsame Frage nach dem Ob und dem Wie, JA 2011, 810; Pünder/Buchholtz, Einführung in das Vergaberecht, JURA 2016, 1246 und 1348; Pünder/Dittmar, Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden, JURA 2005, 760.
Teil IV Staatshaftungsrecht
§ 24 Systematische Übersicht
892
Im Verwaltungsrecht gibt es ebenso wie im Privatrecht eine Vielzahl von Beseitigungs-, Erstattungs- und Schadensersatzansprüchen. Ansprüche wegen Leistungsstörungen bei verwaltungsvertraglichen Schuldverhältnissen und anderen verwaltungsrechtlichen Sonderverbindungen wurden bereits im dortigen Sachzusammenhang behandelt (s.o. Rn 811, 818und 827). Hinzu kommen Ansprüche, die außerhalb einer solchen Sonderverbindung entstehen. Diese werden im Folgenden dargestellt und überwiegend unter dem Begriff „Staatshaftungsrecht“ zusammengefasst[1]. Dieser Begriff ist zwar etwas ungenau. Denn er suggeriert eine Beschränkung auf Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche, obwohl der Sache nach auch Beseitigungs-, Unterlassungs- und Erstattungsansprüche erfasst werden. Er hat sich aber gleichwohl etabliert[2]. Das Staatshaftungsrecht hat nur teilweise eine Kodifizierung erfahren; überwiegend werden die Ansprüche aus verfassungsrechtlichen Grundsätzenabgeleitet und sind richterrechtlichfortentwickelt worden.
893
Diese Ansprüche werden von zwei Grundgedanken geprägt: Die erste Gruppe wird bestimmt vom Gedanken einer Wiederherstellung oder Erzielung der Rechtmäßigkeit. Zu ihr gehört insbes. der Folgenbeseitigungsanspruch, mit dem die Folgen rechtswidrigen staatlichen Handelns rückgängig gemacht werden sollen (s.u. § 25). Eng mit ihm verwandt ist der öffentlich-rechtliche Unterlassungsanspruch, der die Unterlassung rechtswidrigen staatlichen Handelns zum Ziel hat (s.u. Rn 909 ff). Aber auch der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch verfolgt einen ähnlichen Gedanken, indem rechtsgrundlose Vermögensverschiebungen rückgängig gemacht werden sollen (s.u. § 26). Da diese Ansprüche allesamt darauf abzielen, einen in Einklang mit der Rechtsordnung befindlichen Zustand zu erreichen, ergänzen sie die klassischen Möglichkeiten zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit und können daher auch als Primäransprüchebezeichnet werden[3].
894
Im Gegensatz dazu sind Sekundäransprücheauf die nachträgliche Geltendmachung von Schadensersatz oder Entschädigungsleistungen ausgerichtet. Zu ihnen gehört insbes. der Amtshaftungsanspruch (s.u. § 27). Hinzu kommen Entschädigungsansprüche wegen Eigentumsbeeinträchtigungen oder sonstiger Aufopferung für das Gemeinwohl (s.u. § 28). Vor dem Hintergrund der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (s.o. Rn 181 f) ist allerdings die Wahrung oder Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der (Verwaltungs-)Rechtsordnung vorrangig. Daraus folgt ein grundsätzlicher Vorrang des Primärrechtsschutzesgegenüber dem Sekundärrechtsschutz[4], der in Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG auch verfassungsrechtlich verankert ist[5]. Besonders deutlich zum Ausdruck kommt dieser Vorrang in der Bestimmung des § 839 Abs. 3 BGB: Danach tritt die Ersatzpflicht nach dem Amtshaftungsanspruch nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden (dazu Rn 969 f).
895
Eine Systematisierung dieser diversen Anspruchsgrundlagen ist bislang nicht gelungen[6]. Dies wird zu Recht kritisiert[7]. Dem daher begrüßenswerten Anliegen des Bundesgesetzgebers im Jahre 1981, ein einheitliches Staatshaftungsgesetzdes Bundes einzuführen, hat das BVerfG jedoch eine Absage erteilt; denn zum damaligen Zeitpunkt fehlte dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für ein solches Regelwerk[8]. In Reaktion darauf wurde im Jahre 1994 dem Bund in Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 GG ausdrücklich die Gesetzgebungskompetenz für den Bereich der Staatshaftung zuerkannt. Von dieser Kompetenz hat der Bund jedoch bislang keinen Gebrauch gemacht.
895a
Die Corona-Pandemiehat auch im Staatshaftungsrecht viele neue Rechtsfragen aufgeworfen. Das hierbei im Mittelpunkt stehende Infektionsschutzgesetz (IfSG)[9] enthält in §§ 56 ff IfSG spezifische Entschädigungsansprüche[10]. Da diese in ihrer Reichweite aber deutlich begrenzt sind, ist verstärkt erörtert worden, ob und inwieweit die allgemeinen Ansprüche des Staatshaftungsrechts zur Anwendung gelangen könne. Für Primäransprüche, insbesondere also für den Folgenbeseitigungs- und den Unterlassungsanspruch (dazu ausf. § 25) ist dies ohne Einschränkung zu bejahen, da sie nicht auf spezifische Bereiche beschränkt sind. Allerdings knüpfen sie an die Rechtswidrigkeit staatlichen Handelns an. Oftmals, wenn auch nicht durchgehend, haben die Verwaltungsgerichte jedoch die Rechtmäßigkeit der in der Pandemie verhängten Maßnahmen bestätigt[11]. Die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Maßnahmen hat Ende 2021 auch das BVerfG konstatiert[12]. Von den Sekundäransprüchenkommt der Amtshaftungsanspruch (dazu ausf. § 27) zwar zur Anwendung[13]; seine Voraussetzungen sind aber ebenfalls regelmäßig nicht erfüllt. Soweit hier nicht bereits eine Amtspflichtverletzung zu verneinen ist, fehlt es oftmals an einem Verschulden[14]. Und die allgemeinen Aufopferungsansprüche (dazu ausf. § 28) werden nach der Vorstellung des Gesetzgebers verdrängt[15]. Im Einzelnen ist jedoch vieles umstritten (dazu auch Rn 1020aund Rn 1044)[16].
Ausbildungsliteratur:
Kratzlmeier, Die Systematik des Staatshaftungsrechts, JURA 2018, 1239; Lege, System des deutschen Staatshaftungsrechts, JA 2016, 81.
§ 25 Der Folgenbeseitigungs- und Unterlassungsanspruch
896
Fall 26:
Der Träger der Straßenbaulast ist nach § 18f BFStrG vorzeitig in den Besitz eines des A gehörenden Stücks Lands eingewiesen worden, um eine Fernstraße zu erweitern. Bedienstete des Trägers der Straßenbaulast reißen einen Zaun ab und schieben den Mutterboden vom zukünftigen Straßenland. Das Verwaltungsgericht erklärt die vorzeitige Besitzeinweisung für rechtswidrig und später auch den Planfeststellungsbeschluss zur Verbreiterung der Straße. A fordert, dass der Mutterboden an seinen Ursprungsort zurückgeschoben und der Zaun neu gebaut wird. Mit Recht? Rn 912
897
Der Folgenbeseitigungsanspruch (im Folgenden FBA) ist der Gruppe der Primäransprüchezuzurechnen (s.o. Rn 893). Er ist im Unterschied zu Entschädigungs- und Schadensersatzansprüchen nicht auf eine Geldleistung ausgerichtet, sondern auf die Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustands, der vor einem rechtswidrigen Eingriff in subjektive Rechte bestand[1]. Von der bereits aus dem Privatrecht bekannten Naturalrestitution unterscheidet er sich dadurch, dass er nicht den hypothetischen Zustand, der ohne den rechtswidrigen Eingriff bestünde, zum Ziel hat, sondern den tatsächlichen Zustand, der vor diesem Eingriff bestand (sog. „status quo ante“)[2]. Deshalb bleiben Entwicklungsmöglichkeiten, die erst nach dem Eingriff entstehen können, unberücksichtigt.
Читать дальше