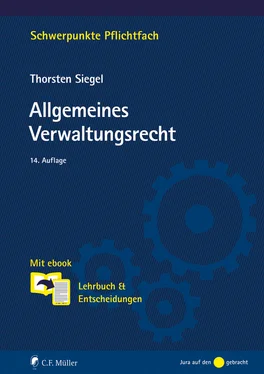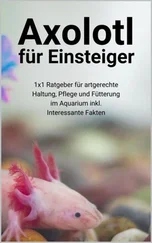Beispiel:
Ein Unternehmen wird rechtswidrig verpflichtet, nach dem Außenwirtschaftsgesetz ein Depot zu unterhalten; mangels Unmittelbarkeit kann es die Zinsen für den deshalb aufgenommenen Kredit nicht im Wege des Folgenbeseitigungsanspruchs fordern[36]. – Die Zinsen kann das Unternehmen nur fordern auf der Basis von Anspruchsgrundlagen, die nachfolgend in §§ 27, 28 dargestellt werden: Amtshaftung, Entschädigung wegen enteignungsgleichen Eingriffs.
907
Die hM bejaht die Anwendbarkeit des Rechtsgedankens des § 254 BGB. Liegt eine entsprechende Mitverantwortlichkeit[37] vor, so führt sie je nach Reichweite zunächst zur Anspruchsminderung, in besonderen Fällen sogar zum Ausschluss des Anspruchs[38]. Problematisch ist die Situation, wenn der Bürger eine unteilbare Leistung verlangt, zB den Widerruf einer ehrenrührigen Erklärung. In diesen Fällen muss es darauf ankommen, bei wem die überwiegende Schuld liegt; liegt sie beim Bürger, entfällt ein Folgenbeseitigungsanspruch, liegt sie bei der Behörde, so muss sie – um im Beispielsfall zu bleiben – die ehrenrührige Erklärung widerrufen. Ist die Leistung teilbar, so hat sich nach dem BVerwG[39] der Bürger entsprechend seinem Mitverantwortungsanteil an den Kosten zu beteiligen[40].
VI. Durchsetzung des Folgenbeseitigungsanspruchs
908
Der Folgenbeseitigungsanspruch ist ein öffentlich-rechtlicher Anspruch; er ist deshalb vor den Verwaltungsgerichten geltend zu machen. Er verjährt regelmäßig in drei Jahren, vgl § 195 BGB i.V.m. § 199 BGB[41]. Die statthafte Klageart ist beim allgemeinen FBA die allgemeine Leistungsklage[42]. Wenn es um die Beseitigung der Folgen des Vollzugs eines angefochtenen VA geht, also beim Vollzugsfolgenbeseitigungsanspruch, so hat der Bürger die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO nach § 113 Abs. 1 S. 2 VwGO zu beantragen, die Folgen des VA rückgängig zu machen; dabei handelt es sich in prozessualer Hinsicht um einen Annexantragzur Anfechtungsklage[43]. Hat sich der VA erledigt, so dauert der rechtswidrige Zustand nicht mehr an, und ein Vollzugs-FBA scheidet aus[44]. Muss hingegen zur Beseitigung der Folgen zunächst ein VA erlassen werden, so ist insoweit eine Verpflichtungsklage statthaft[45]; § 113 Abs. 1 S. 2 VwGO findet dann analoge Anwendung[46].
VII. Der Unterlassungsanspruch
909
Vom FBA zu unterscheiden, aber eng mit ihm verwandt ist der Abwehranspruch als öffentlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch[47]. Der gemeinsame Gedanke liegt in der Vermeidung rechtswidriger Eingriffe in subjektive Rechte durch die öffentliche Verwaltung. Anders als der FBA zielt der öffentlich-rechtliche Unterlassungsanspruch aber nicht auf die Wiederherstellung des status quo ante ab, sondern auf die Vermeidung künftiger rechtswidriger Eingriffe[48]. Er ist in zwei Ausprägungen anzutreffen:
| • |
In der Konstellation des einfachenUnterlassungsanspruchs ist bereits ein Eingriff erfolgt und dauert noch an, oder es droht jedoch ein erneuter, vergleichbarer Eingriff[49]. |
| • |
Beim vorbeugendenUnterlassungsanspruch geht es hingegen um die Vermeidung eines erstmaligen Eingriffs[50]. |
910
Die (verfassungs-)rechtlichen Grundlagen des öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruchs entsprechen wegen der engen Wesensverwandtschaft denjenigen des FBA (s.o. Rn 899)[51]. Auch hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen kann grundsätzlich auf die Ausführungen zum FBA verwiesen werden (s.o. Rn 900 ff)[52]. Besonderheiten ergeben sich aus der Zukunftsorientierung des öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruchs: Eine dem FBA vergleichbare Gefährdungslagebesteht lediglich dann, wenn beim einfachen öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch eine konkrete Wiederholungsgefahrvorliegt[53], beim vorbeugenden Unterlassungsanspruch der erstmalige Eingriff unmittelbarbevorsteht[54]. Zudem kommen die beim FBA anerkannten Ausschlussgründe(s.o. Rn 904) nicht zur Anwendung; denn die Unterlassung rechtswidriger Eingriffe ist stets möglich und zumutbar.
911
Der öffentlich-rechtliche Unterlassungsanspruch verjährt – ebenso wie der FBA – gemäß § 195 BGB i.V.m. § 199 BGB regelmäßig in drei Jahren[55] und ist vor den Verwaltungsgerichten durch die Erhebung einer Unterlassungsklageals Unterfall der allgemeinen Leistungsklage geltend zu machen[56]. Besondere Anforderungen gelten hier beim vorbeugenden Unterlassungsanspruch: Da die VwGO grundsätzlich auf nachgängigen Rechtsschutz ausgerichtet ist, bedarf es bei der vorbeugenden Unterlassungsklage eines qualifizierten Rechtsschutzbedürfnisses: Dem Anspruchsinhaber muss es unzumutbar sein, den nachgängigen Rechtsschutz abzuwarten[57].
912
Lösung Fall 26 ( Rn 896):
Anspruchsgrundlage für das Verlangen des A ist der Folgenbeseitigungsanspruch. Das Handeln der Bediensteten des Trägers der Straßenbaulast erfolgt auf der Grundlage öffentlichen Rechts, ist also hoheitliches Handeln. Es greift in das Eigentum des A ein. Es ist nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts rechtswidrig. Der rechtswidrige Zustand dauert an. Die Voraussetzungen des Folgenbeseitigungsanspruchs sind erfüllt. A kann die Wiederherstellung des früheren Zustands aber nur dann verlangen, wenn er tatsächlich möglich und rechtlich zulässig ist sowie die Handlungen für die Wiederherstellung des früheren Zustands der Verwaltung zumutbar sind. Die Wiederherstellung des früheren Zustands ist tatsächlich möglich und rechtlich zulässig; Bedienstete der Verwaltung können den Mutterboden verschieben und den Zaun aufbauen; dass dieses Handeln rechtlich unzulässig ist, ist nicht ersichtlich. Der Aufwand zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ist auch nicht unverhältnismäßig groß; deshalb ist er der Verwaltung zumutbar. Die Forderung des A besteht zu Recht.
Ausbildungsliteratur:
Barczak, Behördliche Warnung vor E-Zigaretten (Fallbearbeitung), JuS 2014, 932; Brugger, Gestalt und Begründung des Folgenbeseitigungsanspruchs, JuS 1999, 625; Bumke, Der Folgenbeseitigungsanspruch, JuS 2005, 22; Daiber, Flüchtlingsunterbringung, JA 2016, 760; Ellerbrok, Die Grenzen der Zurechnung im Rahmen des Folgenbeseitigungsanspruchs, JURA 2016, 125; Frank, Das Eigentor (Fallbearbeitung), JuS 2018, 56; Hebeler, Unterlassungsanspruch gegen Schneeablagerungen im Zuge des gemeindlichen Winterdienstes, JA 2021, 703; Kemmler, Folgenbeseitigungsanspruch, Herstellungsanspruch, Unterlassungsanspruch, JA 2005, 908; Mehde, Der Folgenbeseitigungsanspruch, JURA 2017, 783; Peters, Der „Ekel“-Pranger (Fallbearbeitung), JURA 2014, 752.
§ 26 Der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch
913
Fall 27:
A wird zum Regierungsrat ernannt. Er möchte mehr Geld verdienen und vereinbart deshalb mit der Anstellungskörperschaft vertraglich ein zusätzliches Gehalt von € 500 pro Monat. Dieses Gehalt wird ein halbes Jahr lang bezahlt. Die Behörde meint dann, das Gehalt sei rechtswidrig gezahlt worden und fordert € 3000 zurück. A hat den Betrag beim Kartenspielen verloren und beruft sich auf den Wegfall der Bereicherung. Muss A den Betrag zurückzahlen? Rn 928
914
Der öffentlich-rechtlich Erstattungsanspruch zielt auf die Rückabwicklung rechtsgrundloser Vermögensverschiebungenim öffentlichen Recht ab[1]. Er bildet damit die Parallele zum privatrechtlichen Bereicherungsanspruch. Im öffentlichen Recht erbringt die öffentliche Verwaltung typischerweise auf der Grundlage eines VA oder örV Leistungen für den Bürger. Der VA oder der örV bilden dann den Rechtsgrund der Leistungserbringung. Dieser Rechtsgrund kann von Anfang an fehlen: Ein rechtswidriger VA wird mit ex-tunc-Wirkung aufgehoben (s.o. Rn 602); ein örV ist nichtig (s.o. Rn 785 ff). In diesen Fällen stellt sich die Frage nach der Rückabwicklung der fehlgeschlagenen Leistungsbeziehung.
Читать дальше