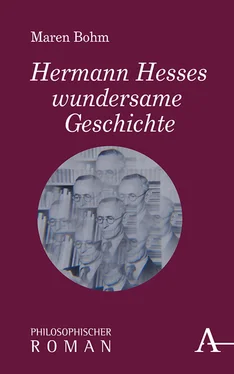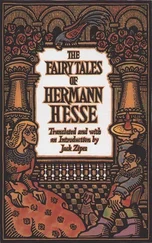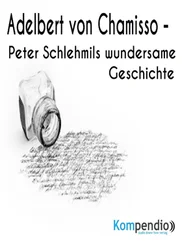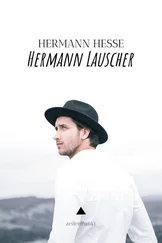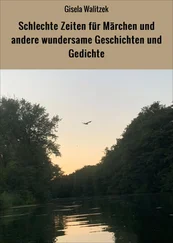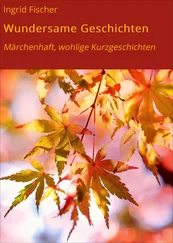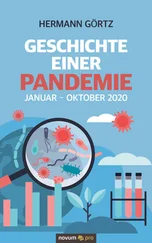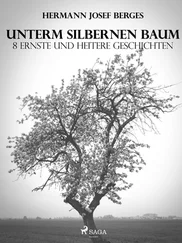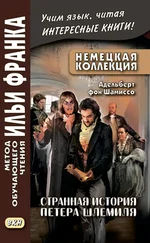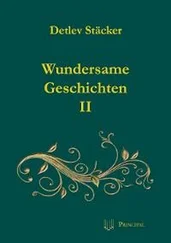Der Entschluss erleichterte Bernd augenblicklich und er war sogar in der Lage, dem Gespräch Karlas mit der Frau zuzuhören. Es ging um Mieterhöhungen in Berlin, konkret um die Mieterhöhung, die im neuen Jahr für ihr Wohnhaus zu erwarten war. Karla aber schien wie verwandelt. War sie auf der Rückfahrt wortkarg gewesen, die Stimmung überhaupt beinahe schmerzhaft bedrückend, blühte sie nun auf. Sie war schön, selbstbewusst, engagiert, so wie Bernd sie aus der Schulzeit in Erinnerung hatte, als sie zusammen für ihre Schülerzeitung, sie für das Mädchengymnasium, er für das Jungengymnasium, einen glühenden Artikel gegen die nach Geschlecht getrennten Schulen schrieben. Gegen den Verdacht aufkommender Unzucht wandten sie ein, dass Sexualität etwas Natürliches und nichts Auszuschließendes sei, ein gemeinsames Lernen jedoch vor allem Teamgeist, ungezwungenen, respektvollen Umgang fördern würde. Für letzteres waren er und Karla ein beredtes Beispiel, niemals hätte er es gewagt, sich ihr mit seiner dicken Brille auch nur zu nähern. Jetzt wirkte sie ebenso engagiert, arrogant und unnahbar. Doch, wie er so neben ihr stand und sie von oben herab mit der Frau sprechen hörte, da widerte ihn Karla an. Als gäbe es für sie nichts Bedeutsameres, Dringlicheres und Hässlicheres als diese Mieterhöhung, in die sie ihr Selbst hineinzuwerfen schien.
»Bringen Sie das in die Zeitung«, rief ihnen die Frau noch nach, als sie schon die Treppe hinaufgingen. Karla redete denn auch bis zu ihrer Wohnung in zwar sachlichem Ton von der Mieterhöhung, gleichwohl war ein Misston nicht zu überhören.
Dann waren sie in ihrer Wohnung. Karla hängte ihre Wildlederjacke an einen Messinghaken, Bernd packte seinen Parka über die Goethebüste.
»Willst du einen Kaffee?«, fragte sie und setzte Wasser auf.
»Nee, mein Magen.«
»Kamillentee?« Klang es ironisch oder einfach mitfühlend?
Bernd nickte.
Sie setzten sich wieder einander gegenüber, Karla auf das Sofa, Bernd auf den Stuhl. Der Kamillentee roch nach Krankheit.
Schweigen.
Karla zündete sich eine Zigarette an, lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander.
»Was hat dich eigentlich an Narziß und Goldmund fasziniert?«
»Die Fische.«
Unwillig zog Karla ihre schöne Stirn in Falten und tippte mit dem Zeigefinger auf ihre Zigarette, dass die Asche in den Meißenaschenbecher fiel, in dessen Mitte eine rosa Rose ihre zarten Blätter zur Knospe verschlossen hatte.
»Fische sind ein Schlüssel zu Hermann Hesses Werk«, fuhr Bernd unbeirrt fort. »Nach dem großen Sterben, nach der Pest geht Goldmund über den Fischmarkt. Es wird wohl in Würzburg sein, denn wie Hesse schrieb, finden sich im Goldmund Spuren davon. Goldmund also schlendert über den Fischmarkt, wo ein paar Fischweiber ihre lebende Ware feilbieten. Er starrt in die Bottiche zu den schönen schimmernden Tieren hinein und er hat Mitleid mit den Fischen und ist wütend auf die Weiber und die Käufer und er erinnert sich, wie er schon früher die Fische bewundert und bemitleidet hat und sehr traurig geworden ist. Er kann sich nur nicht erinnern, worüber. Goldmund ist eben kein Intellektueller.
Hesse selbst gibt darüber Aufschluss. Er beschreibt einen Gang durch Würzburg. Er sieht auf einem nach Stein und Wasser riechenden Plätzchen in Brunnentrögen und aufgestellten Bütten die Main-Fische zu Markte gebracht, die mit schönen goldenen Augen glotzen. Er empfindet Liebe für sie, grüßt sie als stumme Brüder, weil er weiß, wie es ist, gefangen zu sein, aus der eigenen Welt entrissen, verurteilt zu einer Luft, die man nicht atmen, zu einem Licht, an dem man nur sterben kann. Mit feisten Händen packt eine Händlerin einen langen edlen Fisch, einen Augenblick schwebt er mit goldenen, wehen Augen vor Hesses Gesicht, entgleitet mit einer verzweifelten Bewegung und springt glitzernd über das nasse Steinpflaster hinweg. Hesse floh davon.
Karla, in diesen wenigen Zeilen steckt eine ganze Welt. Mit den wenigen Adjektiven schön, schimmernd, golden, edel umfasst Hesse die Vollkommenheit der Fische, die darauf beruht, dass sie wie jeder Stein, jeder Grashalm, jede Blume, jedes Tier nach ihrem eigenen Sinn wachsen und leben. Vollkommen machtlos jedoch sind die Fische den feisten Händen der Fischweiber ausgeliefert. Selbst da, wo ein Barbe noch zu entkommen versucht, ist er ohnmächtig und dem Sterben preisgegeben.
Schon viel früher, in Hesses Roman Roßhalde, bildet ein Fisch das Leitmotiv für das Weh der Kreatur. Es ist eine Szene auf dem Rhein von unerbittlicher Wirklichkeit, verewigt durch das Bild des Malers. Dargestellt ist die zugreifende Hand des Fischers, das offene Maul des Fisches. Das Ganze ist kalt, bis zur Grausamkeit traurig. Das offene Maul findet sich wieder in dem grässlich verzogenen Mund, in dem Schrei des sterbenden Kindes. Und die Züge des toten Kindes sind voll unbegriffenem Leide. Hesse erklärt es selbst, das unentrinnbare Ausgeliefertsein des Fisches, das verzweifelte sinnlose Sterben des Kindes hat keine andere Symbolik als die bedrückende Unbegreiflichkeit der Natur.«
Karla, die sich anfangs lässig zurückgelehnt hatte, beugte sich vor, blickte in Bernds Gesicht, das, je mehr er erzählte, weicher, offener und dabei konzentrierter geworden war. Jetzt nahm er seine Brille in die Hand, wischte seine Gläser an seinem Pullover ab, schaute auf zu ihr, bevor er die Brille wieder aufsetzte. Karla erschrak, wie schöne, und erstaunlich große braune Augen Bernd hatte.
Sie schluckte und fragte dann in spöttischem Ton: »Und was hat das nun mit Goldmund zu tun?«
»Goldmund stellt das Gegenteil zu unbegriffenem Leid dar«, erwiderte Bernd, verwundert über den Wandel von Interesse zu Abwehr.
»Goldmund verkörpert das Glück oder genauer: das geglückte Leben. Hesse sagt selbst, seine Vorstellung vom Glück, diesem, wie er schreibt, holden, kurzen, glänzenden Wort, kristallisiert sich in der goldenen Spur des Goldmund.
Was aber heißt Glück für Hesse? Es heißt nicht, wie man meinen könnte, ein permanentes Glücksgefühl, zum Glück können durchaus Schmerz und Leid gehören, Glück heißt für Hesse, das eigene Schicksal zu finden, dem eigenen Sinn zu gehorchen, der Stimme des eigenen Lebens zu folgen. Sünde ist es, von sich wegzukommen. Konkret heißt es für Goldmund: Frauenliebe, Unabhängigkeit und Kunst.«
»So so«, sagte Karla und stand abrupt auf. »Wenn ich Goldmund richtig verstanden habe, liebt er wahllos Frauen, die er verlässt, wenn er sie ausgekostet hat. Das ist denn wohl das Gegenteil von unbegriffenem Leid.«
Irritiert schaute er Karla an, wie sie so aus dem Fenster starrte, rauchte, die Mundwinkel nach unten gezogen.
»Du nennst es Egoismus. Hesse nennt es Eigensinn, nämlich nach dem eigenen Sinn zu leben.
Hesse sieht seinen Goldmund keineswegs als Ideal an, ebenso wenig wie es seine Aufgabe als Dichter ist, sich ideale, vollkommene, erlogene, ja erlogene Figuren auszudenken. Hesse ist ehrlich genug zuzugeben, dass ihm von der Geschlechtsliebe nicht viel mehr zu erleben möglich gewesen sei als Goldmund, wobei zu bedenken ist, dass Hesse streng und fromm erzogen wurde, wovon er sich niemals wirklich gelöst hat. Jedoch ist Hesse nicht gewillt, zugunsten irgendeiner Vollkommenheit in seinen Büchern Erlebnisse darzustellen, die ihm das Leben selbst versagt hat.«
»Entschuldige«, sagte Karla und wandte sich Bernd zu. »Ich verwechsele für gewöhnlich nicht die Kunst mit dem Leben. Erzähle einfach weiter.«
»Frauen bedeuten also Goldmund nichts als sinnlichen Genuss. Das Verhältnis zum Weibe, um einmal Hesses Ausdruck zu gebrauchen, führt nicht zur seelischen Selbstfindung. Goldmund erreicht die Sublimierung der Liebe erst in der Kunst. Hesse bekennt sich auch persönlich dazu, er möchte um der Frau willen nicht lieben, er bedürfe des Umweges über die Kunst, um das Leben erträglich zu finden.«
Читать дальше