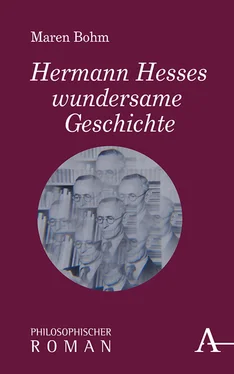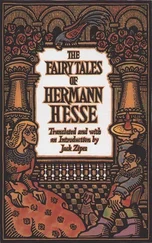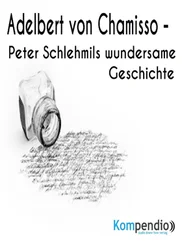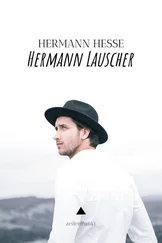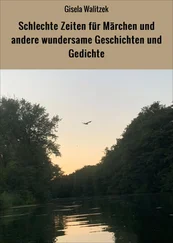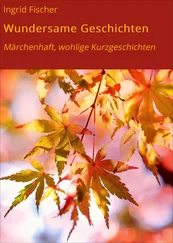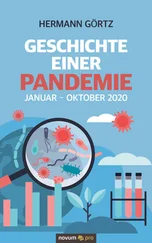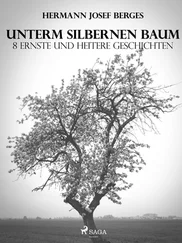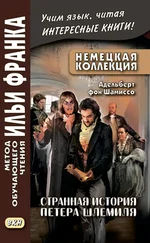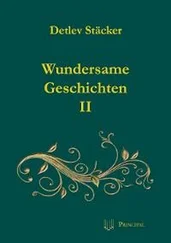»Hm«, zog Karla die beiden Buchstaben in die Länge und zündete sich eine Zigarette an. »Dann lassen wir die frühkindliche Sozialisation ganz weg. Warum wollte wohl Hesse nichts über die Herkunft sagen? Er selbst war doch der Ansicht, dass in den ersten sechs Lebensjahren die Eindrücke am mächtigsten seien.«
»Da ist zwischen Autor und Figur zu unterscheiden. Hesse ist Künstler und da spielt wie bei Goldmund das Mütterliche eine große Rolle, wenn auch zusehends nicht als konkrete Mutter, sondern als Urmutter. Narziß aber verkörpert das Geistige – und das wird nicht geboren, es stirbt auch nicht, es ist ewig, zeitenlos. Narziß ähnelt darin Demian, der ebenfalls seinen Freund Sinclair zu sich selbst führt. Von dessen Gesicht heißt es, es sei irgendwie tausendjährig, irgendwie zeitlos, von anderen Zeitläufen geprägt als wir leben.«
»Das klingt nach Idealisierung und Abstraktion. Das sehe ich bei Narziß nicht, auch wenn es von ihm heißt, er sei vollkommen. Er gehört zwar zu den Auserwählten, leidet jedoch und ist gefährdet, das steht gleich am Anfang und wird dadurch betont. Dass er gefährdet ist, könnte unser Ausgangspunkt sein. Wirklich, hier steht es wieder:
Dieser junge Schüler ist ein wenig gefährdet. «
Sie blätterte kribbelig erregt weiter:
»Hier erneut der Ausdruck Gefahr und dass sich Narziß den Kern seines Lebens nicht berühren lassen dürfe. Ja, was ist denn die Gefahr?«
»Hochmut. Narziß sagt selbst von sich: Es mag wohl sein, daß ich hochmütig bin, gnädiger Vater . Und später: Sein Leben war ein Dienst am Geiste, ihm war sein strenges Leben gewidmet, und nur heimlich, in seinen unbewachtesten Augenblicken, erlaubte er sich den Genuß des Hochmutes, des Besserwissens, Klügerseins. Nein, mochte die Freundschaft mit Goldmund noch so verlockend sein, sie war eine Gefahr, und den Kern seines Lebens durfte er von ihr nicht berühren lassen. «
»Wird dieses Motiv der Gefährdung im zweiten Teil des Romans, ich meine, als vom Abt Narziß die Rede ist, wieder aufgenommen?«
»Teil – teils. Da ist von Kämpfen die Rede: Lesen wir doch einmal: Du solltest mich nicht beneiden, Goldmund. Es gibt keinen Frieden, wie du so meinst. Es gibt den Frieden, gewiß, aber nicht einen, der dauernd in uns wohnt und uns nicht mehr verläßt. Es gibt nur einen Frieden, der immer und immer mit unablässigen Kämpfen erstritten wird und von Tag zu Tag neu erstritten werden muß. Du siehst mich nicht streiten, du kennst weder meine Kämpfe beim Studium, noch kennst du meine Kämpfe in der Betzelle. Es ist gut, daß du sie nicht kennst. Du siehst nur, daß ich weniger als du Launen unterworfen bin, das hältst du für Frieden. Es ist aber Kampf, es ist Kampf und Opfer wie jedes rechte Leben, wie das deine auch.«
»Ja, und inhaltlich? Wogegen, gegen was kämpft denn Narziß. Was oder wer ist der Gegner?«
»Das bleibt offen. Noch mehr, Narziß will es nicht preisgeben. Er sagt ja selbst, es sei gut, dass Goldmund nichts von seinen Kämpfen wisse.«
»So ein Schelm. So müssen wir ihm das Geheimnis entlocken.«
»Schelm? Wenn sich da nicht irgendwelche Dämonen auftun.«
»Lassen wir das mal«, entschied Karla nüchtern. »Ich meine, dass die Gefährdung und die Kämpfe, und Narziß spricht ja selbst davon, dass nur sie ein rechtes Leben ausmachen, das Leitmotiv unseres Romans sein sollten. Gucken wir, was wir im Text zu Narziß’ Kämpfen herauslesen können. Und daraus basteln wir den Roman. Genauer, schreibst du den Roman.«
»Mach mir bloß nicht Angst.«
»Weißt du, was ich unheimlich an Narziß finde«, bemerkte Karla, während sie sich mit Bernd über das Buch beugte, »dass Narziß, dass er ›Gesichte‹ hat, dass er vorhersehen kann, wie jemand stirbt. Darin sieht ja Abt Daniel eine Gefährdung. Ich glaube, daraus lässt sich was machen. Dem Abt Daniel sagt Narziß ja ein schönes, ruhiges Ende voraus, was ist aber, wenn Narziß einen grausamen Tod in einem Gesicht sieht? Wie verhält er sich dann? Kann er ihn abwenden? Er sagt ja von sich: Diese Eigenschaft, ein Gefühl für die Art und – höre! – Bestimmung der Menschen zu haben, zwingt mich, den anderen dadurch zu dienen, daß ich sie beherrsche. Beherrschen klingt nicht sehr sympathisch, klingt nach Manipulation. Aber ich glaube, das meint Narziß nicht. Er meint wohl, sie zu führen, zu sich selbst zu führen. Aber das könnte doch wiederum bedeuten, dass diese Leitung in ein grauenhaftes Sterben führt, weil es das Schicksal des Menschen ist.«
»Es könnte Narziß’ Kampf sein«, schlussfolgerte Bernd, »wie weit er in das Leben eines anderen eingreifen darf. Oder anders: Inwiefern das Schicksal vorherbestimmt ist, Narziß zwar die Gabe besitzt, eben dieses Schicksal vorauszusehen, sich deshalb bemüht, es aufzuhalten, und dennoch die Katastrophe nicht verhindern kann.«
»Damit hätten wir das Problem der Schuld«, stellte Karla fest.
»Ja und nein. Es gibt für Hesse wohl nur diese eine Sünde, nicht man selber zu sein. Lies mal, was er zu Goldmund sagt: Auch wenn du morgen unser ganzes hübsches Kloster niederbrennen würdest, ich würde keinen Augenblick bereuen, dir auf den Weg geholfen zu haben. «
»Das ist irre«, rief Karla begeistert und schlug vor Freude mit der flachen Hand auf den Tisch. »Das müssen wir verwenden.«
»Schon sonderbar«, stimmte Bernd zu. »Besonders da Hermann Hesse selbst als Schüler einmal in den Verdacht geraten ist, in Maulbronn das Pfründhaus in Brand gesteckt zu haben. An seine Eltern schrieb er zwar einen Brief, in dem er ausführlich schildert, wie er die ganze Nacht mit anderen versucht hat, den Brand des großen Hauses zu löschen. Aber als er dann als Vierzehnjähriger so plötzlich nach dem Mittagessen aus Maulbronn davonlief, ohne Mantel, ohne Geld, mitten im Winter, aber mit seinen schweren Schulbüchern, da traute man ihm diese Tat zu. Übrigens hat ein anderer Schüler auf dem Totenbett die Brandlegung gestanden.«
Karla blickte ihrem Zigarettenrauch nach und sagte dann in nachdenklichem Ton: »Ich wollte auch mal fortlaufen.«
Bernd ging darauf nicht ein, nahm das Buch in die Hand.
»Ob wir das verwenden wollen? Sachte. Ich wollte nur andeuten, Narziß wird Abt. Für ihn bedeutet dieses Amt Dienen: Das Ziel ist dies: mich immer dahin zu stellen, wo ich am besten dienen kann, wo meine Art, meine Eigenschaften und Gaben den besten Boden, das größte Wirkungsfeld finden. Es gibt kein anderes Ziel. «
»Da sehe ich durchaus einen Konflikt«, überlegte Karla, ruhiger geworden, obwohl sie von dem Bild des abgefackelten Klosters noch eingenommen war. »Lies mal: Ich will weder den Reichtum des Klosters vermehren noch den Orden reformieren noch die Kirche. Ich will innerhalb des mir Möglichen dem Geist dienen, so wie ich ihn verstehe, nichts anderes. Ist das kein Ziel? Aber Abt zu sein, ist ja nicht nur ein geistliches Amt, sondern ebenso sehr ein politisches, ein wirtschaftliches, ein rechtliches. Viel Land, Rechte und Leibeigene hat so ein Kloster. Es geht tatsächlich um Macht, um Geld, Besitz. Sündenvergebung gab es ohnehin nur gegen Geld. Also wie verträgt sich dies mit dem Dienen am Geist?«
»Gut, halten wir das fest«, sagte Bernd und schrieb auf seinen Notizblock: Zwiespalt, Kampf zwischen Anspruch des Geistes und weltlichen Forderungen.
»Wenn wir diesen Zwiespalt darstellen, müssen wir die Handlung auch zeitlich verorten«, überlegte Karla. »Hesse gibt ja durch die Pest einen Hinweis auf die Zeit um 1348. Und Narziß hat, wie er selbst sagt, einen politischen Auftrag.«
Bernd nickte. »Ja, im vierten Lebenslauf von Josef Knecht hat Hesse historisch genau gearbeitet und die Zeit zwischen 1700 und 1750 in Württemberg zum Leben erweckt. So genau müssen wir es nicht machen, denn Narziß und Goldmund spielt ja sonst allgemein im Spätmittelalter. Aber die politischen Kämpfe, die Narziß auszutragen hat, müssen schon handlungsrelevant sein.«
Читать дальше