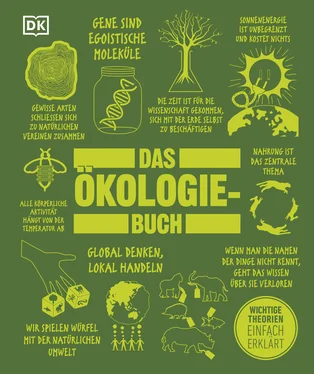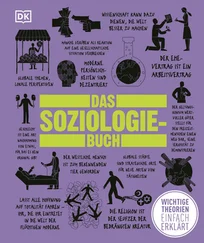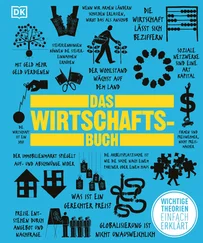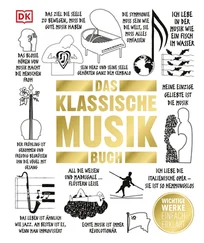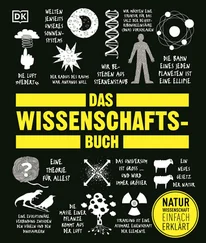Menschen haben seit jeher die Vielfalt des Lebens bestaunt und sie schon mit prähistorischen Höhlenmalereien vor über 30 000 Jahren gefeiert. Aristoteles unternahm im 4. Jahrhundert v. Chr. frühe Versuche, die Lebewesen zu klassifizieren. In seiner elfstufigen Scala Naturae (Leiter der Natur) stehen Menschen an der Spitze über Säugetieren, »primitiveren« Tieren und schließlich Pflanzen und Steinen. Noch tausend Jahre später sah die mittelalterliche Welt Variationen des aristotelischen Systems als gültig an. Dafür gab es mehrere Gründe. Ohne Mikroskope wusste man nichts über Zellen und Mikroben. Ohne die Unterwasserwelt erforschen zu können, fehlte das Wissen über die aquatische Lebenswelt, und viele Regionen der Welt waren westlichen Gelehrten unbekannt. Nach dem vorherrschenden Glauben der katholischen Kirche galt die Natur als statisch und unveränderlich.
Zeitalter der Entdeckungen
Im Zeitalter der großen Entdeckungsreisen erschlossen sich zuvor unerforschte Gebiete mit ihren Tieren und Pflanzen. In der Historia Animalium (1551–1558; dt.: Thierbuch , 1563) beschrieb der Schweizer Arzt Conrad Gessner Funde aus der Neuen Welt und dem fernen Osten, bezog sich aber auch auf klassische Quellen. In dem fünfbändigen Werk unterteilt er die Tiere in Säugetiere, Reptilien und Amphibien, Vögel, Fische und Wassertiere sowie Schlangen und Skorpione.
Die Erfindung des Mikroskops hatte ebenfalls erhebliche Folgen. Der englische Gelehrte Robert Hooke wendete die neue Technik schnell an: Sein Buch Micrographia (1665) inspirierte andere, dasselbe zu tun. Er konnte Objekte bis zu 50-fach vergrößert sehen und fertigte detaillierte Zeichnungen an. Er prägte den Begriff »Zelle«, als er Pflanzenfasern untersuchte. Hooke überlegte auch, ob Fossilien Überreste früheren Lebens sind.
Klassifikation der Vielfalt
Historia Plantarum (1686–1704) des englischen Vikars John Ray ist das botanische Äquivalent zu Gessners Thierbuch und listet in drei enormen Bänden etwa 18 000 Arten auf. Ray führte auch ein biologisches Artkonzept ein: »Eine Art entspringt niemals dem Samen einer anderen.« Der schwedische Botaniker Carl von Linné, der »Vater der Taxonomie«, veröffentlichte Systema Naturae erstmals 1735, aber in der zehnten Auflage von 1758 findet sich das moderne Namensschema. Zwei Bände widmen sich Pflanzen und Tieren, die er in Klassen, Ordnungen, Gattungen und Arten unterteilte. Sein binäres System der zweiteiligen Artnamen – ein Gattungsname mit Artzusatz – wird heute noch verwendet. Linné schrieb einen dritten Band über Gesteine, Mineralien und Fossilien.
Aufbauend auf Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Selektion, festigte der deutschamerikanische Evolutionsbiologe Ernst Mayr das biologische Artkonzept in Systematics and the Origin of Species (1942). Er argumentierte, dass eine Art nicht nur eine Gruppe von morphologisch ähnlichen Organismen ist, sondern eine Gemeinschaft, die sich nur untereinander fortpflanzen kann. Wenn Gemeinschaften innerhalb einer Art isoliert werden, so Mayr, können sie sich mit der Zeit durch Gendrift und natürliche Selektion immer mehr vom Rest der Population unterscheiden, bis sie sogar zu einer neuen Art werden.
Moderne Techniken wie Elektronenmikroskope oder mitochondriale DNA-Analysen haben neue Informationen – und Überraschungen – über die Zahl der Arten und ihre Verwandtschaften geliefert. 1966 wollte der deutsche Entomologe Willi Hennig die Details der Evolution abbilden und schlug ein neues taxonomisches System mit Kladen vor: Verwandtschaftsgruppen mit gemeinsamem Vorfahren. In den 1970ern gruppierte der US-Amerikaner Carl Woese das Leben in drei neue Domänen. Etwa 1,74 Mio. heutige Tier- und Pflanzenarten sind beschrieben (Stand 2018), doch Schätzungen der Gesamtzahl reichen von 2 Mio. bis zu 1 Bio.
Im späten 20. Jahrhundert, als man das Ausmaß und die kritische Rolle der Biodiversität immer besser verstand und erkannte, dass Arten evolutionär nicht nur entstehen, sondern auch aussterben, machten Ökologen wie der US-Amerikaner Edward Wilson der Welt die Folgen menschlicher Aktivität bewusst: die rapide Beschleunigung des Aussterbens. Die Erde könnte sogar auf ein sechstes Massensterben in ihrer Geschichte zulaufen. Viele Maßnahmen werden nun diskutiert, um dies zu verhindern, etwa der Schutz von Biodiversitäts-Hotspots. 

IN ALLEN DINGEN DER NATUR GIBT ES ETWAS BEWUNDERNSWERTES
KLASSIFIKATION DER LEBEWESEN
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Aristoteles(um 384–322 v. Chr.)
FRÜHER
um 1500 v. Chr.Ägypter beschreiben Pflanzen mit verschiedenen Eigenschaften.
SPÄTER
8.–9. Jh. n. Chr.Islamische Gelehrte der Umayyaden- und Abbasidendynastie übersetzen viele Werke von Aristoteles ins Arabische.
1551–1558Conrad Gessner klassifiziert in dem Buch Historia Animalium die Tiere der Welt in fünf Hauptgruppen.
1686–1704John Ray publiziert in Historia Plantarum eine Liste mit 18 000 Arten.
1735Carl von Linné entwickelt die binäre Nomenklatur, das erste konsistente System zur Klassifikation der Lebewesen. Damit listet er jede Art in seinem Systema Naturae auf.
Seit Beginn der dokumentierten Geschichte haben Menschen versucht, Lebewesen nach ihrem Nutzen einzuordnen. So zeigen ägyptische Wandmalereien von etwa 1500 v. Chr., dass die medizinische Wirkung vieler Pflanzen bekannt war. In der Historia Animalium (Geschichte der Tiere) unternahm Aristoteles im 4. Jahrhundert v. Chr. den ersten ernsthaften Versuch, Lebewesen zu klassifizieren sowie Anatomie, Verhalten und Entwicklung zu studieren.
Aristoteles unterteilte die Lebewesen in Pflanzen und Tiere. Dann gruppierte er die Tiere in ungefähr 500 Arten nach offensichtlichen anatomischen Merkmalen, etwa ob sie Blut besitzen, ob sie »warmblütig« oder »kaltblütig« sind, ob sie vier oder mehr Beine haben und ob sie lebend gebären oder Eier legen. Er notierte auch, ob Tiere an Land, im Meer oder in der Luft leben. Vor allem gab Aristoteles den Gruppierungen Namen, die man später als genus und species ins Latein übersetzte – diese werden auch heute noch in der Taxonomie als die lateinischen (und englischen) Begriffe für »Gattung« und »Art« verwendet. Aristoteles ordnete die Lebewesen nach der Art ihrer Geburt auf einer elfstufigen Scala Naturae (Leiter der Natur) an. Tiere auf den obersten Stufen gebaren lebende, warme, feuchte Nachkommen, die auf den unteren Stufen legten kalte, trockene Eier. Menschen standen auf der obersten Stufe, darunter kamen lebend gebärende Tetrapoden (Vierfüßer), Wale und Delfine, Vögel sowie eierlegende Tetrapoden. Auf unterster Stufe standen Mineralien und darüber Pflanzen, Würmer, Schwämme, Insekten mit Larven sowie Schalentiere.
»Sollte jemand gleichwohl meinen, die Betrachtung der übrigen Tiere sei etwas Niedriges, so müsste er in gleicher Weise auch von sich selber denken. «
Читать дальше