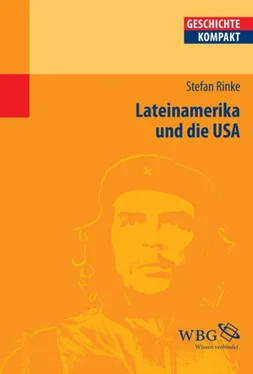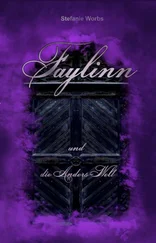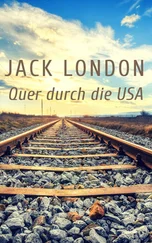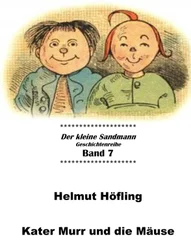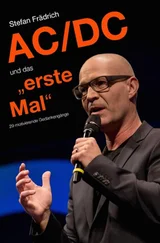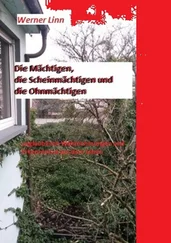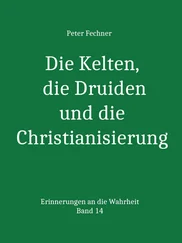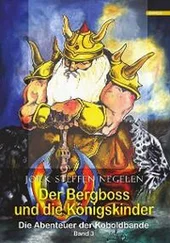Zwischenräume
Zwischenräume des Kontakts bildeten sich nur dort heraus, wo Anglo- und Hispanoamerika gemeinsame Grenzen hatten wie im karibischen Raum und im Südwesten Nordamerikas. Dort waren es oftmals gerade die rechtlosen Unterschichten, die diese Kontakte herstellten, wenn etwa afroamerikanische Sklaven in der Karibik zu den Spaniern flohen, weil sie hofften ihre Lage dadurch zu verbessern oder wenn umgekehrt die Mosquito-Indigenen in Britisch Honduras die Briten unterstützten, um nicht unter das Joch der Spanier zu kommen. Diese alltäglichen Vorkommnisse beeinflussten indirekt durchaus auch die Haltung der Eliten. So reagierten die englischen Autoritäten in ihren Stellungnahmen zur Behandlung der Sklaven sensibel auf die spanische Politik der Einbeziehung der Schwarzen in den Milizdienst. Die spanischen Würdenträger wiederum ahmten die Diplomatie der Briten und Franzosen im Umgang mit den Indigenen nach und gingen im Grenzland im Lauf der Zeit selbst zum Abschluss geschriebener Verträge über.
viele neue Welten
Im Lauf der Kolonialzeit hatte sich die von den Europäern ursprünglich als Raumeinheit gedachte „Neue Welt“ differenziert und pluralisiert. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es viele neue Welten, die von unterschiedlichen europäischen Mächten abhängig waren. Dazu zählten auch die englischen und iberoamerikanischen Kolonien, die sich bedingt vor allem durch den konfessionellen Unterschied von Beginn an als Antagonisten betrachteten. Kolonisten im Norden und im Süden imaginierten sich ihre Neue Welt als protestantisches oder katholisches gelobtes Land, in dem für das Andere kein Raum war. Dennoch blieben sie in vielerlei Hinsicht auf einander bezogen, nicht zuletzt durch die große Herausforderung, die Amerika für alle seine neuen Bewohner darstellte.
II. Amerika gegen Europa: Unabhängigkeitsrevolutionen, 1760 – 1830
| 1756 – 1763 |
Siebenjähriger Krieg |
| 1762 |
Engländer besetzen Havanna und Manila |
| 1776 – 1783 |
Nordamerikanischer Unabhängigkeitskrieg |
| 1783 |
Francisco de Miranda bereist die USA |
| 1791 – 1804 |
Sklavenrevolution in St. Domingue |
| 1803 |
USA kaufen Louisiana von Frankreich |
| 1805 |
Seeschlacht von Trafalgar |
| 1808 |
Napoleon besetzt die iberische Halbinsel |
| 1810 – 1826 |
Unabhängigkeitskriege in Lateinamerika |
| 1810 |
US-amerikanische Annexion Westfloridas |
| 1811 |
US-Kongress: „No-Transfer-Doktrin“ |
| 1812 – 1814 |
Krieg der Vereinigten Staaten gegen England |
| 1819 |
Adams-Onís-Vertrag |
| 1823 |
Monroe-Doktrin |
| 1826 |
Erster Panamerikanischer Kongress in Panama |
Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich zwar am offiziellen Status der amerikanischen Kolonien in Nord- und Südamerika nichts geändert, doch hatten sich diese Regionen gesellschaftlich und politisch in einer Weise fortentwickelt, dass man auch von einer De-facto-Autonomie gesprochen hat. Sowohl im englischen als auch im iberischen Machtbereich kam es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einer Reformpolitik der jeweiligen Mutterländer im Rahmen des aufgeklärten Absolutismus, durch die die Kolonien nun wieder stärker von den europäischen Herrschaftszentren aus kontrolliert und ausgebeutet werden sollten. Die bereits in den Amerikas geborenen und sozialisierten Eliten waren jedoch nicht bereit, diese Reformpolitik widerstandslos hinzunehmen. Diese „Kreolen“, wie man sie in Hispanoamerika nannte, entwickelten vor diesem Hintergrund neue Identitäten, die sich auf die Räume der jeweiligen Heimatregion in Amerika bezog. Dies trug zu einer zunehmenden Entfremdung vom Mutterland bei, die schließlich in Unabhängigkeitsbewegungen gipfelte.
Die Phase vom Beginn der Reformpolitik, bis zum Abschluss der Unabhängigkeitskriege in Hispanoamerika, als 1826 die letzten spanischen Truppen das südamerikanische Festland räumten, war eine Periode enormen Wandels, in der sich die Grundlagen der Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika herausbildeten. Waren die Unabhängigkeitsbewegungen in Nord und Süd, die sich in diesem Zeitraum abspielten, parallele, wenn auch zeitversetzte Prozesse der Loslösung von europäischen Mutterländern, so lassen sich bei allen Gemeinsamkeiten doch auch zahlreiche Unterschiede in Ursachen, Verlauf und Folgen erkennen. Diese Unterschiede sollten auch die Räume des Kontakts prägen, die sich nun in kurzer Zeit vervielfachten.
1. Der Wandel in den internationalen Beziehungen
Zweifellos stellte der Siebenjährige Krieg einen wichtigen Ausgangspunkt für diese Umwälzungen dar. Schon die Kriege der ersten Jahrhunderthälfte hatten gezeigt, dass Spanien und sein Kolonialreich immer mehr zum Spielball der englisch-französischen Kämpfe um die Seeherrschaft wurden. Zwei Jahre nachdem die Auseinandersetzungen in den nordamerikanischen Kolonien ausgebrochen waren, entflammte der Konflikt in Europa, aus dem sich die spanische Krone über Jahre hinweg heraushielt. Erst 1762 trat Spanien an der Seite Frankreichs in den Krieg gegen England ein. Grund war die Angst vor dem englischen Machtzuwachs in Amerika, denn die Engländer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits große Erfolge in Nordamerika und Westindien gegen die Franzosen errungen und unter anderem Guadeloupe besetzt.
Allerdings ging das Kalkül der Spanier nicht auf. Im Gegenteil, England spielte seine Übermacht zur See auch gegen die spanischen Besitzungen aus und besetzte noch 1762 das stark befestigte Havanna und Manila. Der Krieg wurde damit für die Spanier zum Desaster. Die Friedensschlüsse von Fontainebleau (1762) zwischen England und Spanien und Paris (1763) mit Frankreich brachten eine territoriale Neuordnung in Amerika. Spanien trat Florida an England ab und erkannte die englische Oberhoheit über alle Gebiete östlich des Mississippi an. Gleichzeitig musste es nun auch offiziell die britische Herrschaft in Zentralamerika – in Britisch Honduras – anerkennen. Dafür erhielt es das bis dahin französische Louisiana inklusive New Orleans und hatte in der südlichen Karibik keine Verluste zu verkraften.
absolutistische Reformpolitik
Der Kriegsausgang veranlasste die Spanier ihre Reformpolitik in den Kolonien zu intensivieren. Insgesamt hatte sich die Lage für das spanische Kolonialreich 1763 insofern geändert, als Spanien nun in Amerika mehr oder weniger allein gegen die englischen Ansprüche und Schmuggeltätigkeit stand. Schließlich hatte England die Franzosen aus Nordamerika verdrängt. Damit taten sich Konfliktlinien vor allem im circumkaribischen Raum, im Norden Neu-Spaniens und an der nordamerikanischen Westküste auf.
An dieser problematischen Lage ändert auch der nordamerikanische Unabhängigkeitskrieg nichts. Auf Seiten der spanischen Krone weckten die Probleme der Briten mit ihren aufmüpfigen Kolonien in Amerika nach 1763 Hoffnungen. Später unterstützte Spanien wie Frankreich den angloamerikanischen Unabhängigkeitskampf zunächst finanziell und dann ab 1779 auch militärisch. So gab man Anleihen an die nordamerikanischen Revolutionäre, ließ Florida von den Engländern zurückerobern und betrieb Handel mit den Indianern im Mississippi-Tal. Außerdem öffnete man die karibischen Häfen für den Handel mit den Nordamerikanern. All diese Maßnahmen waren dazu gedacht, England zu schwächen. In der Tat brachte der Friedensvertrag von Versailles 1783 einen Erfolg. Florida fiel noch mal an Spanien zurück.
Allerdings verlor England seine Vorherrschaft zur See dadurch nicht. Außerdem führte der fragwürdige Sieg den Spaniern die Entstehung eines neuen fulminanten Faktors in der Amerikapolitik vor Augen: die jungen Vereinigten Staaten. Die Taktik zur Schwächung Englands war also ein zweischneidiges Schwert, denn die spanischen Besitzungen in Florida und anderen Teilen Nordamerikas waren durch den Expansionsdrang der Kolonisten potenziell bedroht. Nicht zuletzt in der Frage des Besitzes von Florida standen die jungen Vereinigten Staaten in einem latenten Gegensatz zum spanischen Kolonialreich. Führende spanische Politiker wie Graf Aranda (1719 – 1798) äußerten sich daher schon früh besorgt über die Folgen der nordamerikanischen Unabhängigkeit für Hispanoamerika. Daraufhin wurden in Amerika aber auch in Spanien Ideen entwickelt, die auf eine Reorganisation des Reichs hinausliefen.
Читать дальше