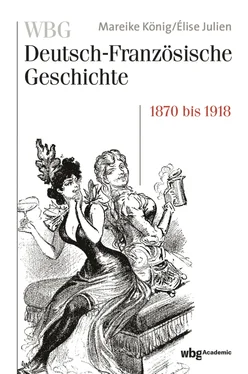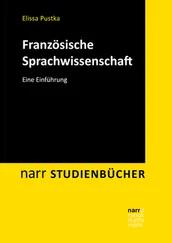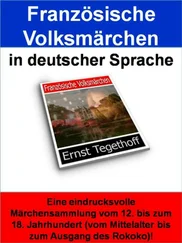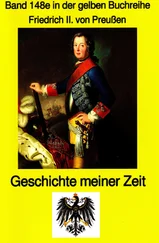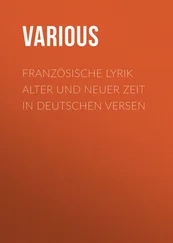Im Oktober 1918 bewegt eine Debatte die Ebene ziviler und militärischer Führungsträger, bevor sie in die Öffentlichkeit gelangt: die einer levée en masse (Massenaushebung). Für Michael Geyer, der ihre Bedeutung betont, konnten Revolution und Niederlage erst ihren Lauf nehmen 55, als die Option eines Volkskrieges oder eines Endkampfes – oft nur mit größtem Widerwillen wie im Falle des Reichskanzlers Max von Baden – beiseite geschoben war.
Die politische Entscheidung des Kanzlers und des Reichstages, keinen Endkampf mithilfe einer Massenaushebung zu führen – eine Möglichkeit, die vor allem von Walther Rathenau unterstützt wurde –, als die militärische Niederlage, wie vom Führungsstab zugegeben, vollzogen war, zeugt von großem politischen Mut: „Wichtiger als die militärischen und die Belange des Nationalstolzes war es, den Krieg durch politische Mittel zu beenden“ 56, schreibt Michael Geyer, nicht ohne anzufügen, dass diese Entscheidung der Ausgangspunkt für tiefe soziale und politische Spaltungen war. Für viele auf Seiten der Rechten und der extremen Rechten war der Endkampf nur vertagt.
Die Erzählungen vom Kriegsende und dem Anfang der Weimarer Republik betonen nun aber immer den „verdeckten Streik der Soldaten“ und die „Verdrossenheit“ 57der Zivilbevölkerung. Selbst wenn diese Phänomene echt sind und sich auf chronische Weise verschärfen, als die dramatischen Nachrichten vom Zustand der Armee an der Front durchsickern, darf man nicht vergessen, dass diese Haltung einer mächtigen Bewegung allgemeiner Remobilisierung, vor allem im Jahr 1918, folgte. Dieser Augenblick der Remobilisierung war selbst eine Episode enormen Einsatzes, der 50 Monate lang – mit Höhen und Tiefen – die Bevölkerung beider Länder mobilisiert hatte.
Die Demobilisierung von im Krieg befindlichen Körpern und Geistern folgte also auf sehr große Erwartungen. Sie war auch weniger die Ursache als die Konsequenz der militärischen Niederlage. In Deutschland zerbrach die „Dynamik der Zustimmung“ 58angesichts des Wissens um die Niederlage.
Detlev Peukert hat außerdem betont: „Angesichts der millenarischen Hoffnungen, die der Weltkrieg geweckt hatte, musste jeder Friedensschluss zur Enttäuschung führen“ 59. Dies ist umso wahrer, als diese „millenarischen Hoffnungen“ und andere „eschatologischen Erwartungen“ ein letztes Mal in der ersten Hälfte des Jahres 1918 anschwollen und sich bis zur Idee einer Massenaushebung oder eines Endkampfes im Oktober hielten. Dabei erreichten diese Hoffnungen ein Niveau, das sie seit 1914 nicht mehr hatten. Es handelte sich hier weniger um Euphorie – schwer möglich nach vier Jahren Massensterben – als vielmehr um den Entschluss, den Sieg zu erzwingen, um Frieden zu haben.
Sebastian Haffner, damals ein Jugendlicher, verdeutlicht diese geistige Remobilisierung sehr gut: „Ich wartete tatsächlich auf den Endsieg noch in den Monaten Juli bis Oktober 1918, obwohl ich nicht so töricht war, nicht zu merken, dass die Heeresberichte trüber und trüber wurden und dass ich nachgerade gegen alle Vernunft wartete“ 60. An anderer Stelle fügt er hinzu: „Wie aber so ein Kriegsende ohne Endsieg aussehen würde, davon hatte ich keinen Begriff; ich musste es erst sehen, um es mir vorstellen zu können“ 61. Trotz des verdeckten Streiks, der so gerne als untrügliches Zeichen der Verdrossenheit gewertet wird, verhinderten die Frontsoldaten nicht, dass 1918 die heftigsten Kämpfe des ganzen Krieges stattfanden, und das noch vor dessen Höhepunkt, den die minoritäre Selbstmobilisierung der Freikorps darstellte. Die Verlustraten vom Frühjahr zum Sommer 1918, als die Deutschen in die Offensive und schließlich in die Defensive gingen, sind in der Tat die höchsten des Krieges 62. Die Zäsur tritt in den Einheiten auf, die in diesem letzten Ansturm dezimiert wurden, als der Sieg nicht mehr denkbar scheint und als individuelle Überlebensstrategien die Oberhand gewinnen. Aber auch diese dominieren nicht völlig, da sehr viele, komplett aufgelöste Einheiten weiterkämpfen und Schritt für Schritt zurückweichen, beherrscht von der Angst, dass der „Verwüstungskrieg“, den sie erlebt haben, in ihr Land transportiert werden könnte 63.
Da sie undenkbar war, stellte man sich die Niederlage sehr lange Zeit nicht einmal vor. Für einige blieb sie unwirklich, beziehungsweise der Krieg blieb unvollendet, und der für 1918 erwartete Endkampf sollte noch kommen.
Auf französischer Seite war das Jahr 1918 ebenfalls von einer geistigen Remobilisierung geprägt. Die „Friedenssehnsucht“ kulminierte 1917 nach der Niederlage der Nivelle-Offensive auf dem Chemin des Dames. Der deutsche Vorstoß vom Frühjahr 1918 lässt noch einmal defensive Phantasien hervortreten, die im Zentrum der französischen Kriegskultur standen. Noch einmal wird Paris direkt bedroht. Die Luftangriffe und der Beschuss der Hauptstadt mit schwerer, weitreichender Artillerie wurden im Januar 1918 wieder aufgenommen, ein Beispiel dafür ist der Beschuss der Kirche Saint-Gervais am 29. März 1918 während des Karfreitagsgottesdienstes. Diese Angriffe prägten die Menschen und schweißten das Land zusammen, indem sie die verschiedensten Zwistigkeiten zwischen Front und Hinterland, zwischen Norden und Süden abmilderten. Als in Paris bei einem Zeppelinangriff am 31. Januar 1918 26 Menschen den Tod erlitten, richtete der Stadtrat von Marseille eine Unterstützungsadresse an die Hauptstadt 64.
Es gibt also neue Kämpfe an der Marne, und in gewisser Weise spielt man 1918 das Jahr 1914 nach. Anschließend erreichen das deutsche Scheitern und die Aussicht auf einen möglichen Sieg eine geistige Remobilisierung für den besten Frieden, der vorstellbar ist: den Sieg. Je schneller er erreicht wird, desto schneller können die Soldaten demobilisert werden und in das normale Leben zurückkehren, auf das sie hoffen. Hier zeigt sich erneut, dass sich die Hoffnung auf den Sieg – die notwendigerweise über den Kampf führt –, die Erschöpfung der Männer und der Wille zum Frieden und zur Rückkehr in den Alltag nicht ausschließen. Die Archive der Postkontrollbehörde bezeugen diesen Anstieg der Truppenmoral und ihren Willen, mit einem Sieg zum Ende zu kommen 65. In gewisser Weise wurden die Ermüdung und der Verschleiß – teilweise – durch die Aussicht auf den Sieg kompensiert. Die Stimmung ist seitdem abhängig vom Vorrücken und vom Fortschritt der Armee, ebenso wie die Lebensbedingungen. Als der Winter näherkommt, während der Sieg schon im Sommer in Reichweite schien, sinkt die Stimmung wieder. Die Beunruhigung wird durch eine Spanische-Grippe-Epidemie verstärkt, die zu wüten beginnt. Aber, wie Bruno Cabanes schreibt: „Diese Erschöpfung der Truppen im September–Oktober 1918 bedeutet auch nicht, dass die Soldaten damit einverstanden wären, dass Frankreich einen raschen Frieden zu jedem erdenklichen Preis unterzeichnet.“ Der Historiker fügt an, dass Formulierungen wie: „Der Moment ist noch nicht gekommen, es ist wichtig den Feind zu schlagen, bevor man mit ihm redet“, die häufigsten in den Soldatenbriefen sind 66. Die immer massivere Ankunft der neuen amerikanischen Alliierten und die zunehmende Entdeckung des Zustands der überfallenen, nun befreiten Territorien tragen ebenfalls zur Remobilisierung der Truppen bei.
Wenn wir auf diese französischen und deutschen Erwartungen von 1914 bis 1918 zurückkommen, 1918 zunächst wiederbelebt, dann ab Ende des Jahres zunehmend demobilisiert, dann deswegen, weil sie in Untersuchungen zumeist vergessen werden – diese beginnen häufig am 11. November 1918. Und das, obwohl die Erwartungen des Sieges und an den Sieg eine wichtige Rolle für das Selbst- und Fremdbild spielen. Sie wiegen schwer im Moment der Konfrontation mit der Erfahrung des Waffenstillstands, der Niederlage, des Sieges und schließlich der Konsequenzen der Friedensverträge.
Читать дальше