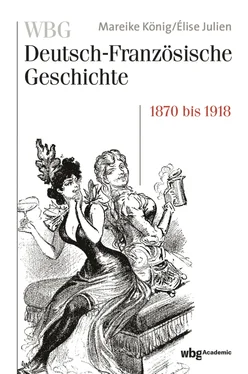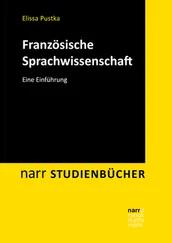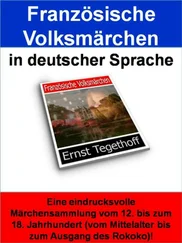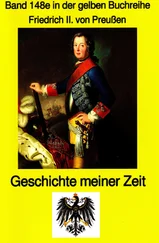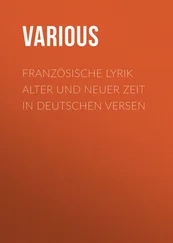„Führt diesen Krieg bis zum Ende, bis zum Ende des Elends, des Leidens, des Unglücks und der Schande, die der Krieg seit Millionen Jahren über die Erde verbreitet hat, opfert euch und gebt euch hin bis zum Ende, damit eure Kinder eines Tages nicht das tun müssen, was ihr getan habt.“ 42
Zweifellos waren die in den Sieg gesetzten Erwartungen von sehr unterschiedlicher Natur. Während die Mehrheit hofft, dass der Krieg „der letzte der letzten“ sein wird, der „Krieg, der allen Kriegen ein Ende setzen wird“, sind die Mittel, um dies zu erreichen, und die mit dieser Idee verbundenen Vorstellungen sehr verschieden. Barbusse versprach sich davon eine neue Welt, besser und befriedet, die nach dem Krieg unter seiner Feder eine kommunistische werden wird. Andere erhoffen sich, Deutschland zu bestrafen oder zumindest durch Waffengewalt und die Verträge eine endgültige Sicherheit für Frankreich und seine Grenzen zu erreichen. Ihrer Meinung nach wird allein diese Sicherheit der Garant für den künftigen Frieden sein.
Aber die Verschiedenartigkeit dieser Erwartungen, die manchmal eine sehr ausgeprägte eschatologische Dimension 43enthalten, verdecken nicht, dass die häufigste Erwartung der siegreiche Frieden ist. Diese Erwartung erklärt, warum eine Mehrheit von Franzosen wie Deutschen, trotz ihrer extremen Kriegsverdrossenheit und ihres Willens, den Krieg bald enden zu sehen, „nicht ertragen konnten, besiegt zu leben“ 44. Diese Tatsache sollte man umso mehr im Hinterkopf behalten, als das Jahr 1918 eine erneute Mobilisierung dieser großen Erwartungen erlebt, hauptsächlich auf eine Rückkehr des Bewegungskrieges, der eine baldige Entscheidung des Krieges voraussehen ließe.
1.2. Ende der Kriegshandlungen und Beginn einer neuen gegenseitigen Feindschaft
Noch vor dem Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918 wurde man sich erst in den Kanzleien und dann der Front bewusst, dass die Entscheidung auf den Schlachtfeldern des Westens fallen würde. Natürlich waren Franzosen und Deutsche bei weitem nicht die einzigen Kriegsparteien, die sich gegenüberstanden, aber der Krieg sollte nun in Frankreich gewonnen oder verloren werden. Obwohl der Krieg ein Weltkrieg blieb – die Auswirkungen des US-amerikanischen Kriegseintritts im April 1917 begannen sich nun direkt bemerkbar zu machen –, wurde er in gewisser Weise im Jahr 1918 wieder deutsch-französisch. Die Geister wurden erneut mobilisiert, und die Hoffnungen auf den Sieg waren, nach der wiederholten Niedergeschlagenheit über die Kriegsdauer und nach den Niederlagen in den großen Materialschlachten der Jahre 1915, 1916 und 1917, wiederbelebt. Das Jahr 1917 war in der Tat durch eine extreme Kriegsmüdigkeit unter den Kriegsparteien gekennzeichnet, vor allem in Deutschland und in Frankreich. Auch wenn Deutschland nicht wie Frankreich große Wellen von Soldatenmeutereien erlebte, so gab es in beiden Ländern vergleichbare umfassende Streiks 45.
Diese Streikwellen hatten Ausläufer bis zu Beginn des Jahres 1918, vor allem in Deutschland mit dem großen Streik im Januar 1918. Ihre Auswirkungen waren sogar über das Jahr 1918 hinaus zu spüren, denn sie wurden den Sozialdemokraten in Deutschland ständig von deren politischen Gegnern zum Vorwurf gemacht.
Dennoch wurde diese „Ernüchterung“ 46ab dem Winterende 1917/1918 unterbrochen. Die geschätzte Anzahl der Streikenden 1917 und 1918 bestätigt diese Unterbrechung: In Deutschland waren es 1917 667.000 und 392.000 im Jahr 1918, und in Frankreich 294.000 1917 und 176.000 1918. Im Jahr 1919 steigen diese Zahlen wieder auf 2 321.000 beziehungsweise 1 151.000 47.
De facto hatte die Aussicht auf das Kriegsende, und damit auf eine letzte Anstrengung zur Beendigung des Krieges, einen gewissen abschreckenden Effekt, der sich in diesem umfassenden Absinken der Anzahl der Streikenden im Jahr 1918 niederschlägt.
Weiterhin muss angefügt werden, dass die Streiks in der Heimat nicht die Solidarität der Frontsoldaten fand, die sie in ihrer ganz großen Mehrheit ablehnte. Diese Tatsache wird besonders deutlich im Fall des deutschen Streiks vom Januar 1918. Die Soldaten – von denen die Mehrheit Bauern waren und aus der Provinz stammten – hielten die Berliner Arbeiter für Privilegierte, die unberechtigterweise den Krieg durch die Streiks verlängerten, und forderten sie auf, zu ihnen an die Front zu kommen 48.
Im Fall Deutschlands können der deutsche Sieg im Osten 1918 und seine Inszenierung durch das Große Hauptquartier, das an seine eigenen utopischen Fiktionen vom Aufbau eines von Deutschland abhängigen Militärstaates glaubt, der Bevölkerung weismachen, dass die Armee ihre Bemühungen auf die Westfront übertragen und schließlich den Sieg davontragen könnte.
Das Abenteuer der Besatzung im Osten und im sogenannten Gebiet Ober Ost wird von intensiven Propagandabemühungen und einer millenarischen Phantasiewelt bezüglich eines Großdeutschland, der Kolonisation und der Vormundschaft über weite Gebiete Osteuropas begleitet. Diese Propaganda und die Erfahrung, die Millionen Soldaten im eroberten Osten machten, generierten neue mentale Karten (mental maps) zeitgleich mit Erwartungen und Ängsten bezüglich der Territorien und ihrer zu kontrollierenden Bevölkerung. Die Erfahrungen bezüglich sozialer und demographischer Projektplanung von Ober Ost, die gekonnt in Szene gesetzt wurden, kultivierten diese Erwartungen und Ängste 49.
Sicherlich kompensiert die Anregung der Vorstellungskraft nicht immer die leeren Bäuche und die immer schwierigeren materiellen Bedingungen, denen die vom Krieg erschöpfte deutsche Bevölkerung unterworfen ist. Die Härte der aufeinanderfolgenden „Steckrübenwinter“, die zum Teil der alliierten Blockade zuzuschreiben sind, und die im Krieg ungefähr 800.000 Tote bedingten 50, bestätigte die Deutschen in ihrer doppelten Überzeugung, einerseits einen gerechteren Krieg als der Gegner zu führen, und dass es andererseits notwendig sei, ihn rasch zu beenden. Der Frieden sollte schnell eintreten, aber auch siegreich sein. Die großen siegreichen Frühjahrsoffensiven 1918 und die Rückkehr zum Bewegungskrieg verstärkten den Eindruck, das Ende sei nah und der Sieg noch immer möglich. Tatsächlich hat die Großoffensive den Effekt einer erneuten Mobilisierung 51, und „das tiefe Streben nach Frieden, das sich in den Korrespondenzen der Soldaten zumindest seit der zweiten Hälfte des Jahres 1916 ausdrückt, geht nun völlig in der Hoffnung auf eine entscheidende Offensive auf“ 52. Die Frustration angesichts des Scheiterns ab dem Sommer hätte größer nicht sein können.
Zugegebenermaßen waren die Erfolge zu Beginn des Frühjahrs überzeugend. Dank eines gewissen Überraschungseffekts aufgrund reduzierter Artillerievorbereitung und der neuen Taktik, mobile Stoßtruppen in das feindliche Grabensystem einsickern zu lassen, ermöglicht es die Offensive Michael ab dem 21. März 1918 zum ersten Mal seit 1914 wieder, die Front in der Picardie zu durchbrechen. Ende Mai wird die Front bei der dritten großen deutschen Offensive im Sektor des Höhenzugs Chemin des Dames nochmals innerhalb von drei Tagen mehr als 60 km tief durchbrochen.
Seither erblickten selbst die am wenigsten kriegerischen deutschen Soldaten, selbst jene, die vorher zu einem Frieden um jeden Preis bereit waren, die Möglichkeit eines siegreichen Friedens, womit sie sich mit denen trafen, für die ein Frieden ohne Sieg undenkbar war. Und erst nachdem Deutschland „seine wesentlichen Ressourcen an Männern und Material in eine intensive Anstrengung hatte fließen lassen, den Sieg zu erzwingen, bevor die Ankunft der amerikanischen Truppen das strategische Gleichgewicht verändern würde, erlebte es eine schwere militärische Krise, die Niederlage und das Chaos der Revolution“ 53. Es stimmt, dass diese zunächst erfolgreiche Offensive extrem kostspielig an Menschen war und die logistische Schwäche einer ausgebluteten Armee ebenso offenbarte wie die Blindheit des Oberkommandos, allen voran Ludendorffs, der Mitte Juli einen Rückzug nach der Niederlage seiner Offensive südlich von Reims ablehnte. Am 18. Juli starteten die Alliierten eine Gegenoffensive im Bereich der Somme. Der Generalstab, und hauptsächlich Prinz Ruprecht von Bayern, begriff nun, dass der Krieg militärisch verloren war. Diejenigen, die sich selbst vom Gegenteil überzeugen wollten, konnten dies nach dem „schwarzen Tag des deutschen Heeres“ am 8. August 1918 nicht mehr: An diesem Tag wird die Offensive von Amiens – durchgeführt vor allem mithilfe von mehr als 400 Kampfpanzern, eine Waffe, an die die Deutschen nicht glaubten – mit 12.000 deutschen Gefangenen und ungefähr 18.000 Toten und Verletzten bezahlt. Das Jahr 1918 ist demnach von extremen Wechseln der Truppenmoral gekennzeichnet, deren revolutionäre und gegenrevolutionäre politische Auswirkungen noch näherer Untersuchungen bedürfen 54.
Читать дальше