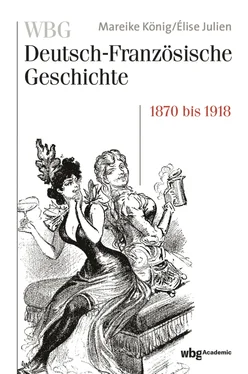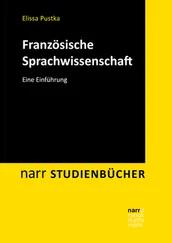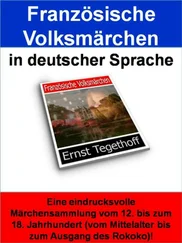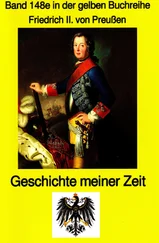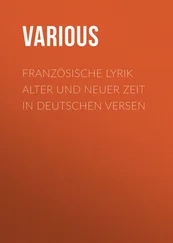Eine in gerader Linie aus dem Krieg entstandene Rhetorik lässt sich erneut bei den französischen Führern vernehmen, wie bei Jacques Seydoux, der am 15. Juli 1922 schreibt:
„Es handelt sich um das Wohl der europäischen Zivilisation. Wir können nicht Deutschland, nach und mit Russland, Europa vergiften lassen. Es muss funktionieren, ob mit Ordnung oder Unordnung, in der Realität oder im Traum, zum Guten wie zum Schlechten“ 212.
Rapallo öffnet de facto gleichzeitig ein Fenster von Möglichkeiten für die Deutschland am feindlichsten gesinnten „Rheinländer“ Tirard und Degoutte. Darüber hinaus ist die Atmosphäre im Land entweder gleichgültig oder offen feindselig gegenüber Deutschland. Es gibt kein echtes innenpolitisches Hindernis gegen eine aggressive Deutschlandpolitik, und als sich die Idee einer direkten Inbesitznahme – implizit eine Besetzung – von „produktiven Pfändern“ präzisiert, stellen sich nur die Kräfte auf der Linken, vor allem die Kommunisten, fest dagegen.
Die fast ein Jahr später „im beschränkten Komitee, durch Staatsmänner, Technokraten“ 213getroffene Entscheidung, das Ruhrgebiet zu besetzen, war in höchstem Maße und in erster Linie eine politische. Indem sie das Ruhrgebiet besetzten, hofften Poincaré und seine Mitarbeiter nicht nur, sich in den Besitz „produktiver Pfänder“ für die Reparationen zu bringen, die Deutschen zum Zahlen zu zwingen und das Heft gegenüber der deutschen und der russischen Diplomatie nach Rapallo wieder in die Hand zu nehmen, sondern auch gegenüber den Kanzleien seiner ehemaligen britischen und amerikanischen Alliierten.
Auch strategische und geopolitische Gründe fehlten bei der französischen Beschäftigung mit dieser Episode nicht 214. Aber die französischen Pläne reichten nicht nur über die Notwendigkeit hinaus, die ungezahlten Reparationen zu decken, sondern auch über die Gebote der Sicherheit. Die französischen Führer hofften auf eine Autonomisierung der Rheinregion nach dem saarländischen Modell und setzten auf eine Destabilisierung des Reichs. Der Vorschlag von Konrad Adenauer und Hugo Stinnes zur Beendigung der Krise, die Gründung „ein(es) Rheinisches Bundesstaates, der freilich im Staatsverband der Weimarer Republik bleiben sollte“ 215, erweckte zweifellos einige Hoffnungen auf französischer Seite, doch die Republik überlebte diese zentrifugalen Versuche, in erster Linie dank der Festigkeit Stresemanns, ebenso wie den beunruhigenden Hitler-Putsch vom 9. November 1923.
In diesem Kontext bedeuten der Dawes-Plan und dann die Locarno-Verträge für die französischen Entscheidungsträger tatsächlich eine Konversion, die – wie es Georges-Henri Soutou so schön beschreibt – darin besteht, „nicht mehr nur gegen das Reich zu denken, sondern mit ihm“ 216. Es handelte sich darum, von der „Zeit der Erfüllung zu der der Verhandlung“ 217überzugehen.
175WIRSCHING 1999 [187], S. 89.
176Ebd., S. 45–57.
177Zitiert nach BECKER/BERSTEIN 1990 [236], S. 190.
178AGULHON 1990 [234], S. 332.
179BECKER/BERSTEIN 1999 [236], S. 196.
180Ebd., S. 198.
181JEANNESSON 1998 [614], S. 53.
182MOUTON 1995 [466], S. 223–260. Zu dieser Frage siehe Kapitel II.4.2. Zur Ruhrbesetzung siehe II.5.
183PROST 1977 [378]und PROST 1977 [379].
184Zum Pazifismus siehe Kapitel II.7.; KITTEL 2000 [510], S. 261–294; PROST 1977 [378]und PROST 1977 [379], INGRAM 1991 [502].
185ZIEMANN 1997 [420], BRANDT/RÜRUP 1991 [569].
186BARTH 2003 [270], S. 407–486.
187WEHLER 2003 [230], S. 358.
188SABROW 1999 [535], HAFFNER 2002 [50].
189KITTEL 2000 [510], S. 277–278.
190BERGHAHN 1966 [484]; VINCENT 1997 [227], S. 460.
191ROHE 1966 [531]; VINCENT 1997 [227], S. 385.
192U. a. SOUTOU 2006 [666], SOUTOU 2004 [665], JEANNESSON 1998 [614], SCHIRMANN 2006 [474].
193U. a. LAUTER 2006 [634].
194BUFFET 1998 [440], SCHULZE WESSEL 2001 [477].
195JEANNESSON 1998 [614], S. 7–83.
196SCHIRMANN 2006 [474], S. 52.
197Die Beispiele stammen aus SCHIRMANN 2006 [474], S. 53–54. Für den späteren Zeitabschnitt: SCHIRMANN 2000 [472].
198Zu den jetzt gut bekannten Vorläufern: BARIÉTY 1977 [430], JEANNESSON 1998 [614], SOUTOU 2004 [665], Fischer 2003 [589], LAUTER 2006 [634].
199LAUTER 2006 [634], S. 261–264.
200Zitiert nach BARIÉTY 1977 [430], S. 69.
201Ebd.
202LAUTER 2006 [634], S. 266.
203BARIÉTY 1977 [430], S. 73.
204Ebd., S. 74.
205Zitiert nach LAUTER 2006 [634], S. 266.
206JEANNESSON 1998 [614], S. 132–136 und 208–217 und auch LAUTER 2006 [634], S. 254–264.
207BARIÉTY 1977 [430], S. 86. Über Briands Werdegang siehe u.a.: UNGER 2005 [142].
208Zu dieser Frage siehe II.4. Die Literatur wird dort zitiert.
209WINTZER 2006 [480], S. 243–253.
210BARIÉTY/POIDEVIN 1977 [434], S. 249. Zur Politik Poincarés siehe JEANNESSON 1998 [614].
211Poincaré am 22. Mai 1922, zitiert nach JEANNESSON 1998 [614], S. 76.
212Zitiert nach ebd., S. 77.
213JEANNESSON 1998 [614], S. 141–143 unterscheidet drei Gruppen, die auf die Entscheidung Einfluss nehmen: die ‚Rheinländer‘ (hohe Verantwortungsträger bei der Besatzung der rheinischen Territorien), die Beamten verschiedener Ministerien, die sich für verschiedene Aspekte der Operation interessierten – vor allem ökonomisch-industrielle –, und Poincaré selbst. Über das Zögern und die Intervention Belgiens: YPERSELE 2004 [679]und MIGNON 2005 [646].
214Für ein zusammenfassendes Resümee: JEANNESSON 1998 [614], S. 137–143.
215WEHLER 2003 [230], S. 408.
216SOUTOU 2004 [665].
217BARIÉTY 1977 [430], S. 755.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.