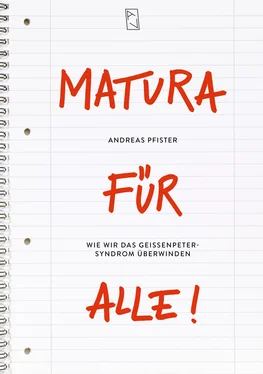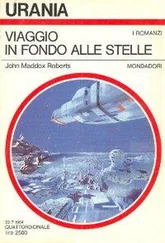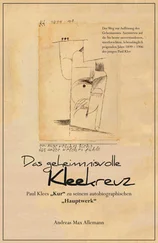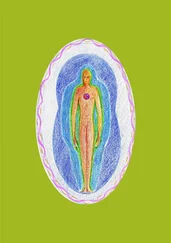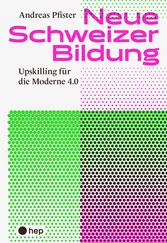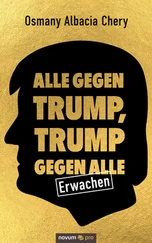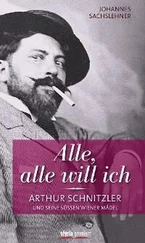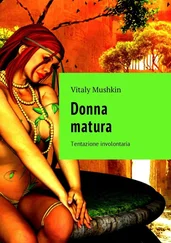Gegenwärtig stehen im Fokus der öffentlichen Empörung jene, die wollen, aber kaum können. Gerne vergessen werden dabei die anderen. Nämlich die, die sehr wohl könnten, aber nicht wollen. Hier liegt viel Potential verborgen. Im Gegensatz zur Kritik an der angeblichen Förderwut hört man kaum von einer Empörung über Eltern, die das schulische Fortkommen ihrer Kinder vernachlässigen. Ihre unterlassene Hilfeleistung wird selten kritisiert. Dass bildungsferne Eltern ihren Kindern mit Bildungsverachtung, Gleichgültigkeit, spöttischen Bemerkungen über die angebliche Faulheit von GymnasiastInnen usw. die Freude an der Schule vergällen, ihnen teilweise sogar Steine in den Weg legen, daran scheint sich kaum jemand zu stören. Im Gegenteil: Man ist froh, dass nicht noch mehr ans Gymnasium drängen.
Bewegung in die Bildungspolitik können derzeit nur die Akademikereltern bringen. Das ist nicht unproblematisch, denn es geht ihnen um ihr Partikularinteresse – und nicht um das Gemeinwohl. Doch indem sich Akademikereltern für ihre eigenen Kinder einsetzen, könnten sie quasi als Nebeneffekt das Gymnasium und die Universitäten auch für bildungsferne Jugendliche öffnen. Das ist zwar nicht das, was man sich als Ideal vorstellt, doch auf dem Boden der politischen Tatsachen dürfte sich dieser Weg als der pragmatischste und zugleich aussichtsreichste erweisen.
Schon heute kommt das Bisschen an Druck auf die Bildungspolitik vor allem aus bildungsaffinen und zugleich etablierten Kreisen. Ins Feld geführt wird zum Beispiel der Standort Schweiz als Wirtschaftsfaktor. Internationale Unternehmen überlegen sich nicht nur, wo die Steuern günstig sind. Sie berücksichtigen auch weichere Faktoren wie zum Beispiel das Bildungsangebot für die Kinder ihrer Mitarbeiter. Das internationale Management will seine Kinder meist am Gymnasium sehen – nicht in einem Berufsbildungssystem. Besonders die hochqualifizierten Einwanderer aus Deutschland, also unsere Ärztinnen, Journalisten, Dozentinnen, wollen ihre Kinder gerne an ein öffentliches Gymnasium schicken. Ist das nicht möglich, so helfen sich viele von ihnen selbst und schicken ihre Kinder an eine Privatschule. Die Düpierten sind einmal mehr die Einheimischen, die weiterhin auf die Lehre setzen, und jene, die sich eine Privatschule nicht leisten können. Hochqualifizierte aus fremdsprachigen Ländern wie England, den USA, Frankreich, Osteuropa schicken ihre Kinder schon wegen der Sprachbarriere häufig an International Schools. Der boomende Markt der Privatschulen verzerrt die Schweizer Bildungspolitik zusätzlich. Insgesamt werden jährlich rund fünf Prozent 8der Kinder und Jugendlichen am rigiden Schweizer Selektions-Rechen vorbeigeschleust. Das mag man als nicht besonders viel empfinden. Doch wenn man die Spitzenwerte einzelner Gemeinden mit besonders hoch gebildeter Bevölkerung anschaut, sieht es anders aus. In Zumikon, Rüschlikon und Kilchberg (ZH) besucht mittlerweile ein Viertel der Kinder und Jugendlichen eine Privatschule. In Walchwil (ZG) sind es 23 Prozent, in Wollerau (SZ) 21 Prozent.
Diese PrivatschülerInnen aus wohlhabenden Häusern werden später studieren und Kaderstellen besetzen. Währenddessen bremsen wir die Kinder an öffentlichen Schulen aus. Die zugezogenen Nachbarn schütteln den Kopf und fragen sich verwundert: Warum bildet ihr eure Leute nicht selber aus?
KANTONE UND IHRE BILDUNGSKULTUR
Das Thema Chancengerechtigkeit entzündet sich oft an den kantonal unterschiedlichen gymnasialen Maturitätsquoten. 92016 reicht die Bandbreite von Obwalden (11 Prozent) und Schaffhausen (13 Prozent) bis zu Genf (29 Prozent) und Baselstadt (30 Prozent). 10
Man stösst sich schon lange an den ungleichen Maturitätsquoten in den Kantonen. Aktuelle Umfragen, die allerdings mit der nötigen Vorsicht zu handhaben sind, zeigen einen weitverbreiteten Wunsch in der Schweizer Bevölkerung nach einheitlichen Maturaprüfungen und -quoten. Darf es sein, dass ein Jugendlicher aus Baselstadt die dreimal höhere Chance hat, ans Gymnasium zu kommen, als ein Jugendlicher aus Obwalden? Sind die Welschen mit ihren generell höheren Maturitätsquoten etwa klüger als die Deutschschweizer, fragt man rhetorisch. Und drückt damit die Vermutung aus, dass in der Romandie einfach die Hürde bzw. das Niveau tiefer sei. Stimmt diese Annahme?
Nicht unbedingt. Wenn in der Romandie die Maturitätsquote höher ist, dann hat das mit dem kulturellen und historischen Stellenwert des akademischen Bildungswegs zu tun, mit der Nähe zu Frankreich und seinem Bildungssystem. Die hohe gymnasiale Maturitätsquote in der Romandie bedeutet nicht, dass dort das Niveau viel tiefer ist als in der Deutschschweiz. Es können in der Schweiz problemlos mehr Jugendliche das Gymnasium machen, ohne dass das Niveau sinkt. Sind die Romands also klüger? Wenn wir davon ausgehen, dass gymnasiale Bildung mehr ist als warme Luft, dann: Ja! Oder man kann differenzieren: Klüger sind sie vielleicht nicht, aber schulisch gebildeter.
Unterschiede gibt es auch zwischen den Kantonen, innerhalb der Kantone, der Städte und Gemeinden. Spiegelt der Unterschied in den Quoten eine Ungerechtigkeit? Ist es in gewissen Gemeinden einfacher, ins Gymi zu kommen? Ist das Niveau dort tiefer? Wenn Akademikereltern in urbanen Zentren mehr Energie in die Vorbereitung ihrer Kinder stecken, wenn sie den Nachwuchs ins Lernstudio schicken, dann kommen diese Kinder auf ein höheres Niveau. Deshalb liegt dort die Quote höher, ohne dass deshalb die Aufnahmeprüfung oder die Maturität leichter wäre.
Akademikerfamilien bemühen sich in der Regel um schulischen Erfolg. Bildungsaffin heisst nicht einfach, dass man Bildung «irgendwie ein bisschen gut findet». Sondern man tut etwas dafür, strengt sich an, investiert Zeit und Energie. Und als Folge davon wird man besser bzw. gebildeter. Deshalb kann man Leistung nicht einfach trennen vom sozialen Hintergrund.
Der Begriff «bildungsfern» 1sei eine Beleidigung, heisst es. 2Doch es erschwert die Verständlichkeit, wenn man immer von Jugendlichen aus «sozio-ökonomisch unterprivilegierten Milieus» oder von «Migrationshintergrund» reden muss. Solche begrifflichen Nebelpetarden liegen im Interesse der Elite. «Elite» soll man übrigens auch nicht sagen. Es gebe sie nämlich nicht, versichert dieselbige. An der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide sagt es sich besonders leicht, dass es eine solche nicht gibt. Sprachliche Tabus sind gut gemeint, doch de facto helfen sie mit, die Unterschiede zu verwischen. Es gibt ein Oben und ein Unten, eine Nähe und eine Ferne. Weshalb soll man das nicht benennen? Gesellschaftliche Hierarchien kann man bekämpfen, verspotten, ablehnen – wie es zum Beispiel die 68er-Generation getan hat. Doch wie will man sich für die Bildungsfernen einsetzen? Wenn es sie denn gar nicht gibt?
BEDEUTUNG SOZIALER KLASSEN
Das Abstreiten von sozialen Klassen und ihrer hierarchischen Ordnung ist ein beliebtes rhetorisches Mittel ebenjener Klasse, die an der Spitze steht. Tatsächlich ist das Klassenbewusstsein unterschiedlich ausgeprägt. Es ist zumal in der Schweiz in den Hintergrund gerückt. Das hat mit der Ausweitung des Mittelstands zu tun. Vor einem halben Jahrhundert machten weniger als 5 Prozent der Bevölkerung das Gymnasium. Entsprechend galt es als Eliteschule. Heute sind es rund 20 Prozent. Da kann man nicht mehr von einer Elite im engeren Sinn sprechen, dafür sind es zu viele. Hinzu kommen die Berufs- und Fachmaturität, die Fachhochschulen, die höheren Fachschulen und andere weiterbildende Institutionen. Die Grenzen sind fliessender geworden.
Dass darüber gestritten wird, ob es überhaupt noch Klassen im historischen Sinn gebe und welche Bedeutung diese heute haben, zeigt, dass die Debatte schon bei der Definitionsmacht ansetzt. Wie kann man den Bildungsfernen besser den Boden unter den Füssen wegziehen, als wenn man bestreitet, dass sie bildungsfern sind! «Ich bin nicht besser als du. Du verdienst zwar weniger, doch du bist genau so viel wert.» Wie soll man sich gegen eine solche Charme-Offensive zur Wehr setzen? Es ist ja nicht so, dass hinter solch netten Worten falsche Absichten stehen. Man empfindet die Müllmänner tatsächlich als Helden. Und unsere Sympathie gehört aufrichtig den Büezern. 3Es ist weder Lüge noch Heuchelei, wenn wir von der Gleichwertigkeit der Arbeit auf einer Baustelle reden. Die traurige Pointe liegt darin, dass es gar keine Rolle spielt, wie wir das meinen. Der Effekt ist derselbe. Ob wir zynisch die Arbeiter von der höheren Bildung wegloben oder aus ehrlich empfundener Sympathie, oder ob wir selbst zu ihnen gehören – es mündet alles in jene diskursive Struktur, welche die faktische Hierarchie der Klassen zementiert. Hat man jemals Hochqualifizierte auf die Gleichwertigkeit ihrer Arbeit pochen hören? Wer weiss, dass seine Arbeit besser bezahlt wird, braucht keine verbale Bestätigung seiner Gleichwertigkeit und auch keine Image-Kampagnen.
Читать дальше