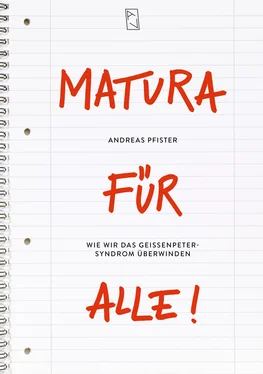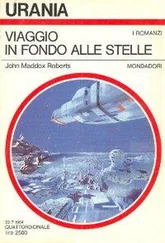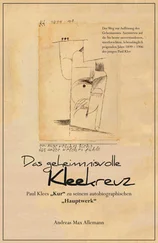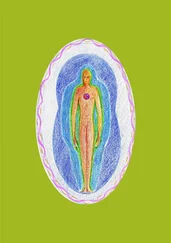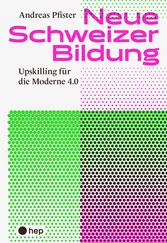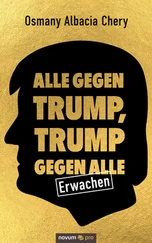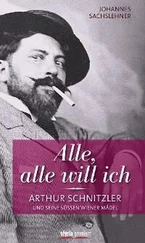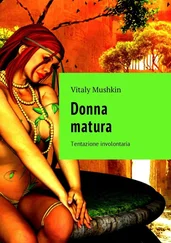Auf der Sekundarstufe II wird nicht von der Gefahr gesprochen, jemand könnte «nur» als Lehrling abgestempelt werden. Die Wertschätzung der Lehre als angebliche kulturelle Eigenart unseres Landes – was sie nicht ist – trägt dazu bei, dass man nicht befürchtet, mit «nur» einer Berufslehre diskriminiert zu werden. Solange die Berufslehre weit verbreitet ist, wird ihr Wert auch geschätzt.
LEISTUNGSUNTERSCHIEDE BEI LEHRLINGEN
BerufsmaturandInnen haben beim Abschluss bereits eine Berufsausbildung. Es ist möglich, auch ohne Studium direkt in die Arbeitswelt einzusteigen. Kein Studium aufzunehmen nach der Berufsmaturität, ist zwar nicht das Ziel, doch es muss nicht zwingend einen Verlust darstellen. Schon jetzt ist es so, dass weniger BerufsmaturandInnen ein Studium an einer Fachhochschule aufnehmen als GymnasiastInnen, die ein Studium an einer universitären Hochschule beginnen. Zwar ist dies angesichts des gegenwärtigen Mangels an Hochqualifizierten bedauerlich. Trotzdem muss eine Berufsmatura für alle nicht eine Fachhochschule für alle nach sich ziehen. Das ist keine verlorene Bildungsinvestition. Die jungen LehrabgängerInnen nehmen einen gut gefüllten Bildungsrucksack mit ins Leben, vielleicht ohne zu wissen, wann genau sie ihn brauchen werden.
Der Unterschied zwischen einem schulisch starken Berufsmaturanden und einem jungen Immigranten, der noch kaum Deutsch kann, soll nicht in Abrede gestellt werden. Niemand behauptet, das Anheben des allgemeinen Bildungsniveaus sei einfach. Das braucht eine Menge Ressourcen und zusätzliche Mittel. Die teilweise hohen Durchfallquoten in bestimmten Branchen sind ein ernst zu nehmendes Problem. Schon heute fragt es sich, wie die Lernenden auf das erforderliche Niveau gebracht werden sollen. Wenn dieses künftig weiter steigt, besteht die Gefahr, eine wachsende Gruppe von Leuten zurückzulassen. Dieses Problem lässt sich nicht einfach lösen. Doch grundsätzlich kann man dieser Gefahr nur durch einen Ausbau der schulischen Bildung begegnen.
Um mit den grösseren Niveauunterschieden in einer neuen, allgemeinen Berufsmaturität umzugehen, kann man Modelle aus der Volksschule übertragen. Eine weitere Möglichkeit neben Niveaustufen sind Leistungskurse. Die Binnendifferenzierung innerhalb einzelner Fächer ist dem Gymnasium nicht fremd. Beispielsweise in der Romandie hat eine Unterteilung des Fachs Mathematik in zwei Niveaustufen eine lange Tradition.
Es stellt sich die Frage, ob die neue Berufsmaturität B, die man auch praktische Maturität nennen kann, ebenfalls zum Studium an einer Fachhochschule berechtigen soll. Es gibt Gründe dafür und dagegen. Dagegen spricht, dass der Studienerfolg weniger sicher ist als mit einer Berufsmaturität A. Dafür spricht, dass LehrabgängerInnen mit einer Berufsmaturität B auf der tertiären Stufe eine neue Chance erhalten sollen. Auch einseitige Begabungen können besser zum Tragen kommen. Deshalb soll im Sinne von mehr Chancen auch die Berufsmaturiät B die Möglichkeit bieten, an einer Fachhochschule zu studieren.
| 03 |
MEGATRENDS DER GEGENWART |
Die Notwendigkeit einer neuen Bildungsoffensive ergibt sich massgeblich aus den steigenden Ansprüchen der Arbeitswelt. Diese betreffen nicht nur die Hochqualifizierten, sondern auch die Berufslehre: die Automatikerin, den Laboranten, die Bauökologin. Die Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft verlangt auf allen Ebenen nach mehr schulischer Bildung. Zum einen braucht es mehr Akademiker, zum anderen braucht es mehr Schule innerhalb der Lehre. Die Vertreter der Berufslehre nennen als Megatrends der Gegenwart unter anderem Globalisierung, Digitalisierung, Dienstleistungsgesellschaft, Upskilling, demografischer Wandel und Migration sowie Ressourcenknappheit beim Staat. 1Gefragt sind Fähigkeiten wie komplexe Probleme lösen, kritisches Denken, Kreativität, eigene Ideen generieren. 2Das heisst nun weder, dass alle studieren müssen, noch, dass die Lehre ausstirbt. Es heisst im Gegenteil, dass man unser Bildungssystem jenseits von ideologischen Grabenkämpfen weiterentwickeln kann – genau so, wie wir das immer schon getan haben.
HOHER INTERNATIONALISIERUNGSGRAD
Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Land und weist einen hohen Internationalisierungsgrad auf. Nicht nur, was den Handel, 3sondern auch, was das Personal angeht. Die Wirtschaft rekrutiert ihre Fachkräfte zunehmend weltweit. 4
Auch in der Bildung ist es nicht mehr möglich, mit der bisherigen Selbstverständlichkeit einen schweizerischen Sonderweg zu gehen. Es gibt in der Schweiz zunehmend internationale Firmen, die mit den Besonderheiten des hiesigen Bildungssystems nicht vertraut sind. Zum Problem kann das unter anderem dann werden, wenn ausländische Personalchefs Schweizer Abschlüsse aus der Berufslehre nicht kennen oder für minderwertig halten und lieber ausländisches Personal mit akademischen Abschlüssen einstellen. Umgekehrt besteht das Problem, dass Abschlüsse der Schweizer Berufsbildung im Ausland teilweise weder bekannt noch anerkannt sind. Seitens der Berufslehre will man diesem Problem insbesondere mit Informationskampagnen begegnen, zum Teil auch mit Umbenennungen der Schweizer Abschlüsse.
Ein Vorstoss, die höhere Berufsbildung mit neuen, dem Bologna-System entlehnten Titeln wie «Professional Bachelor» und «Professional Master» 5aufzuwerten, wurde vom Nationalrat angenommen, vom Ständerat aber abgelehnt. Eine Mehrheit will in der Berufsbildung keine akademisch klingenden Titel. Die Titelfrage entzweit die höhere Berufsbildung und die Fachhochschulen, und sie wird auch die Politik weiterhin beschäftigen.
Die Hoffnung, Informationskampagnen würden ausreichen, muss als reichlich optimistisch angesehen werden. Die Entscheidungsträger sind in diesem Fall zunehmend internationale Personalchefs. Das schönste Berufsbildungssystem bringt wenig, wenn es den Weg in internationale Top-Positionen erschwert. Angesichts der Kräfteverhältnisse ist ein gesunder Realismus gefragt bzw. eine pragmatische Bescheidenheit, die zu unserem Kleinstaat passt. Nicht zu unterschätzen ist die kulturelle Verankerung von Bildungswegen und -abschlüssen. Natürlich können ausländische Personalchefs informiert werden über unsere Schweizer Abschlüsse. Doch von der Information bis zur eigentlichen Verinnerlichung, Vertrautheit und Wertschätzung ist es ein weiter Weg. Im Zweifelsfalle ist davon auszugehen, dass ein HR-Manager nach seinem Bauchgefühl und seinen Emotionen urteilt. Und diese dürften eher dazu führen, dass er Leute mit vertrauten Ausbildungen und Titeln einstellt.
DIGITALISIERUNG, STRUKTURWANDEL, UPSKILLING
Ein weiterer Megatrend ist die allgegenwärtige Digitalisierung. 6Sie wird besonders in schlecht bezahlten Jobs als Bedrohung wahrgenommen. 7Im Alltag zeigt sich das zum Beispiel im langsamen Verschwinden der Verkäuferinnen und Verkäufer in den Supermärkten. Die Digitalisierung verändert die Produktionsweisen, Abläufe, Tätigkeiten und Anforderungen an die ArbeiterInnen.
Der Strukturwandel kommt als weiterer Megatrend hinzu. Der Dienstleistungssektor wächst. Auch das betrifft die Bildung, zumal die Berufslehre. Sie ist nicht nur, aber vor allem im Gewerbe und in der Industrie stark. 8Durch den technologischen Fortschritt nehmen hochbezahlte Berufe zu, niedrig entlohnte nehmen ab. In der neuen gesellschaftlichen Mittelklasse wuchs bis 2016 der Anteil Manager, Techniker und Experten an den Erwerbstätigen auf 48 Prozent. Gleichzeitig fiel jener der Industriearbeiter und Handwerker auf 16 Prozent, jener von Bürohilfskräften auf 8 Prozent. 9Die Dynamik, mit der sich die Arbeitswelt verändert, führt zu Ängsten um den Job.
Die Veränderungen haben eine gemeinsame Stossrichtung: Es sind Fortschrittsbewegungen, welche die Arbeit komplexer, dynamischer und anspruchsvoller machen. Das hat Auswirkungen auf die Bildung: Die Bildung muss auf ein höheres Niveau gehoben werden. Beliebte Beispiele, die das illustrieren, sind etwa der Wandel vom Automechaniker zum Automechatroniker, der über Informatikkenntnisse verfügen muss. Oder der Heizungstechniker, der nicht mehr bloss Rohre zusammenschraubt, sondern komplexe Systeme für Gebäude programmiert. 10
Читать дальше