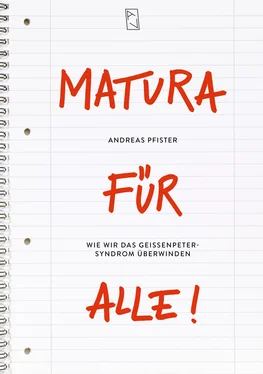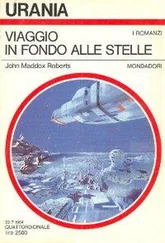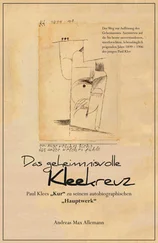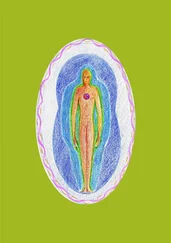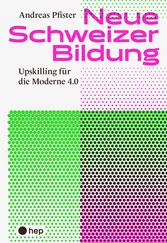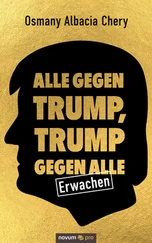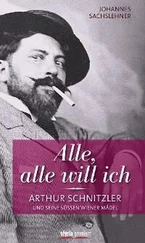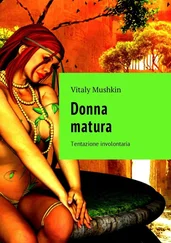Triumphierend wird in verschiedenen Medien die Mehrheit zitiert, 8für die es zu viele Gymnasiasten gibt. Dabei wäre bemerkenswert, dass eine Mehrheit die gymnasiale Maturitätsquote als richtig oder zu niedrig einstuft, wenn man weiss, wie hoch sie ist. Auch Akademiker sind überwiegend der Meinung, es gebe zu viele Gymnasiasten. Nur 8 Prozent von ihnen wünschen sich eine höhere Akademikerquote.
Ein ähnliches Umfrageergebnis macht 2016 die Runde: Dort finden 59 Prozent der Befragten, es gebe in der Schweiz zu viele Maturanden im Verhältnis zu den Lehrlingen. 9Als Schlagzeile fungiert das Zitat eines Politikers: «Schon heute fehlen uns Elektriker oder Bäcker.» Der zitierte Nationalrat schiebt nach: «Gleichzeitig gibt es immer mehr Akademiker, die keinen Job finden.» Nicht in die Schlagzeile schafft es eine andere Politikerin: «Es gibt mit Sicherheit nicht zu viele Gymnasiasten. Sonst würde die Schweiz ja nicht gezwungen sein, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen.»
Ist der Einsatz für höhere gymnasiale Maturitäts- und Akademikerquoten ein Kampf gegen Windmühlen? Eins wird jedenfalls deutlich: Trotz der allgegenwärtigen Diskussion um den Fachkräftemangel und die Einwanderung von Hochqualifizierten bleibt man in der Schweiz dabei: Man will nicht mehr Akademiker. Man setzt hierzulande auf den dualen Weg, auf die Fachhochschulen und die höhere Berufsbildung.
Dass gymnasiale Bildung in bildungsfernen Milieus in Frage gestellt wird, kann man ein Stück weit nachvollziehen. Weshalb sollten sie einen Bildungsweg wertschätzen, wenn sie nicht daran teilhaben? Die Bereitschaft, ein Bildungssystem öffentlich zu finanzieren, funktioniert nur so lange, wie es sein Versprechen einlöst, für alle da zu sein. Aber genau das ist trotz aller Bildungsexpansionen nicht wirklich eingetreten. Noch immer studieren vor allem jene, deren Eltern ebenfalls studiert haben. Die soziale Mobilität ist zwar auf dem Papier gewährleistet, doch in der Realität funktioniert sie schlecht. Die Milieus bleiben unter sich, man geht sich mehr oder weniger höflich aus dem Weg. Wer dereinst studieren wird und wer nicht, das regeln nach wie vor überindividuelle Mechanismen, an die man in einer modernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert nicht gern erinnert wird.
Der Vorschlag einer Matura für alle berücksichtigt das gewachsene Schweizer Bildungssystem und knüpft daran an. So lässt sich die bisherige Berufsmaturität im Nachhinein als – sehr erfolgreichen – Anfang mit Freiwilligen lesen, der jetzt auf alle anderen übertragen werden soll.
Die drei heute bestehenden Maturitätstypen lassen sich vom schulischen Niveau her grob auf zwei Stufen verteilen: Auf der oberen Stufe steht die gymnasiale Maturität, auf der unteren stehen die Berufs- und die Fachmaturität. Dieser Niveauunterschied soll nicht eingeebnet werden. Er bleibt auch im jeweiligen Namen ersichtlich.
Auch mit einer Matura für alle werden in der Schweiz nicht alle Jugendlichen die gleiche Schule durchlaufen. Und es werden nicht alle den gleichen Abschluss machen. Kinder und Jugendliche sind unterschiedlich, und sie werden im Laufe ihrer Schulzeit immer unterschiedlicher. Diesem Umstand soll die Bildung Rechnung tragen. Deshalb soll es nicht eine einzige Maturität für alle geben, sondern drei.
Die Matura für alle ist ein Vorschlag, dessen konkrete Ausgestaltung verschiedene Formen annehmen kann. Die einfachste Variante ist die Erweiterung der bestehenden Maturitätsformen. Als Richtwert kann man je von einem Drittel ausgehen: ein Drittel gymnasiale Maturität, ein Drittel Berufsmaturität, ein Drittel Fachmaturität. 10 Prozent der Jugendlichen erhalten eine Sonderförderung. Innerhalb der einzelnen Maturitätstypen muss sich nicht viel ändern. Die GymnasiastInnen besuchen weiterhin vollzeitlich die Schule, ganz wie die FachmittelschülerInnen. Die BerufsmittelschülerInnen können wie bisher wählen zwischen BM1 und BM2. Noch flexiblere Modelle sind derzeit in Entstehung. 1
Gegenwärtig besuchen die Lehrlinge im System BM1 während zwei Tagen die Berufsschule. Im Modell BM2 gehen sie nur einen Tag hin und hängen ein Jahr Schule an die Lehre an. Das System BM2 ist meist sinnvoller, weil dabei die Doppelbelastung von Schule und Lehre im Rahmen bleibt. Man setzt daher besser auf das System BM2 und entwickelt dieses weiter.
Als weitere Variante könnte eine BM3 eingeführt werden. Das Schuljahr, das im Modell BM2 am Ende der Lehre absolviert wird, kann, weil es künftig alle absolvieren, auch am Anfang der Lehre stehen. Einiges spricht dafür, gerade in wissensbasierten Berufen. Viele Lehrlinge benötigen zuerst eine theoretische Grundlage, um darauf aufbauend das Praktische erlernen und anwenden zu können. Mit der Variante BM3 wäre es auch denkbar, das erste Jahr gemeinsam mit anderen Maturitätstypen zu absolvieren. Der Entscheid für eine Lehre oder das Gymnasium könnte so nach hinten verschoben werden. Es kann hier eine zusätzliche Flexibilität und Durchlässigkeit zwischen den Bildungswegen geschaffen werden. Diese Variante hat bisher wenig Beifall gefunden. 2Trotzdem erwägt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, einzelne Kantone in Form von Pilotversuchen damit starten zu lassen.
Die praktische Bildung könnte auch erst auf tertiärer Stufe erfolgen. Einen Vorschlag für eine Lehre auf tertiärer Ebene hat 2010 Avenir Suisse unterbreitet. 3Die Lehre erst auf tertiärer Stufe beginnen zu lassen, bietet den Vorteil, dass noch grössere Durchlässigkeit zwischen den Maturitätstypen geschaffen wird, dass der Entscheid zwischen Lehre (auf tertiärer Stufe) und akademischem Weg noch später gefällt wird. Der Nachteil liegt darin, dass praktisch begabte und interessierte Jugendliche lange warten müssen, bis sie arbeiten können.
Für die Berufs- und Fachmaturität bietet sich eine Binnendifferenzierung an, so wie wir das heute auf der Sekundarstufe I kennen. Das heisst, man kann eine nach Niveau abgestufte Berufsmaturität A oder B erlangen. Das ergibt eine doppelte Abstufung: die erste zwischen der gymnasialen Maturität einerseits, der Berufs- und Fachmaturität andererseits. Die zweite innerhalb der Berufs- bzw. Fachmaturität.
| GYMNASIALE MATURITÄT |
| BERUFSMATURITÄT,FACHMATURITÄT |
NIVEAU A |
| NIVEAU B |
Die Matura für alle hält fest an der Leistungs- und Wettbewerbsorientierung der Bildung. Dabei sucht sie die Balance zwischen Differenzierung und Integration. Das Konzept einer Matura für alle ist nicht das einer Einheitsschule. Für die Sekundarstufe I, manchmal auch II, werden immer wieder integrierte Modelle gefordert. 4So verlangt man zum Beispiel, das Gymnasium einer Einheitsschule zu opfern. Dagegen ist einzuwenden, dass das Schweizer Bildungssystem nicht nur der Chancengerechtigkeit verpflichtet ist, sondern auch der Leistung und Exzellenz. Wir wollen beides: sowohl Leistung als auch Chancengerechtigkeit. Aktuelle Reformen auf der Sekundarstufe I arbeiten weiterhin an dieser Vereinbarkeit. Vielleicht können progressive Mischformen eine Weiterentwicklung der hier vorgeschlagenen Matura für alle darstellen. Jedenfalls soll die Tür zu integrierten Modellen offenbleiben.
Heute sieht die Gesellschaft die Maturität als eine Art Gütesiegel, um schulisch Starke auszuzeichnen. In der Primarschule ist der soziale Gedanke, Kinder nicht mit dem Stempel «Sonderschüler» auszugrenzen, weitgehend Realität geworden. Auf diesen Fortschritt sind wir stolz.
Von der Sekundarstufe II hingegen wird nicht Integration, sondern Differenzierung erwartet. Besonders auffällig ist dabei, dass dieser Wechsel als natürlich, logisch oder normal empfunden wird, gemäss der Idee: Solange sie Kinder sind, sollen sie alle zusammen zur Schule. Je älter sie werden, desto stärker unterscheiden sie sich.
Читать дальше