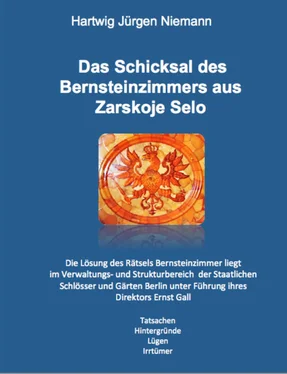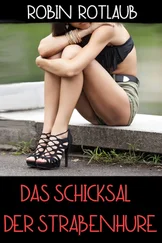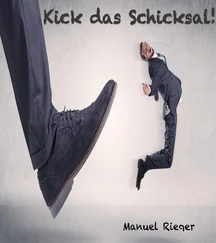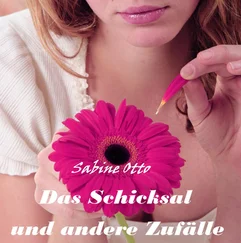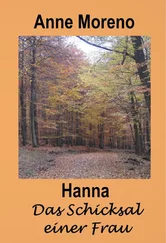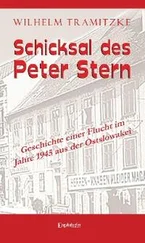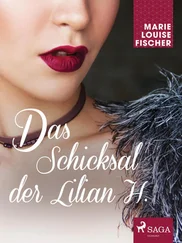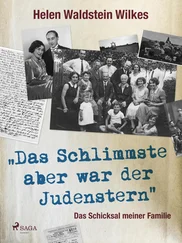Sie gehörten und wirkten zusammen: der Nationalsozialismus, die Heeresmuseen, die Heeresarchive, die Heeresbibliotheken, die staatlichen Museen Berlin und die Verwaltung Staatliche Schlösser und Gärten Berlin.
Sie waren die Initiatoren, um diese nationalsozialistische Idee gegenüber den vom Krieg gebeutelten Menschen - nach der Parole „ Haltet durch wir sind unschlagbar!“ - den immer noch nicht erreichten Endsieg, vorzugaukeln.
Nach diesem angeblichen Endsieg, den es bekanntlich nie gegeben hat, schlüpfte Admiral Lorey wieder in den Bereich der Staatlichen Museen Berlin unter.
Letztendlich waren sie nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges alle wieder miteinander vereint, wenn es auch nur in der 1898 gegründeten Gesellschaft für Heereskunde war, die 1938 in Deutsche Gesellschaft für Heereskunde umbenannt worden war. Diesen Namen hat diese Gesellschaft bis heute behalten. Lorey war während der Nazizeit Ehrenmitglied dieser Gesellschaft und übernahm am 11. November 1953 auf der ersten Jahreshauptversammlung als Ehrenmitglied in Berlin Dahlem den Vorsitz.
Ob die Herren, als sie zusammen geplaudert haben einmal über das verschwundene Bernsteinzimmer polemisiert haben, oder wusste keiner der anderen Herren, dass es Admiral Lorey war, der einmal den beiden Kunsthistorikern Ernstotto Graf Solms zu Laubach und Georg Poensgen einen Auftrag erteilte?
________________
1. Thümmler, Lars Holger: Preußische Militärgeschichte. Das Zeughaus Berlin im Zweiten Weltkrieg. Eine Studie zu den Aufgaben und der Wirksamkeit des Museums, Abschnitt 2.2. Verwaltungsstrukturen. Thümmler beruft sich auf die Zeitschrift für Heereskunde, 1955, Seite 1.
www.grosser-generalstab.de/zeughaus.
2.Thümmler, Lars Holger: Preußische Militärgeschichte. Das Zeughaus Berlin im Zweiten Weltkrieg. Eine Studie zu den Aufgaben und der Wirksamkeit des Museums, Abschnitt 2.2. Verwaltungsstrukturen, Seite 2.
www.grosser-generalstab.de/zeughaus
3. Thümmler, Lars Holger: Preußische Militärgeschichte. Das Zeughaus Berlin im Zweiten Weltkrieg. Eine Studie zu den Aufgaben und der Wirksamkeit des Museums, Abschnitt 2.2. Verwaltungsstrukturen, Seite 1.
www.grosser-generalstab.de/zeughaus.
4. Thümmler: Pkt. 2.2. Verwaltungsstrukturen.
5. Günther Haase, Kunstraub und Kunstschutz. Eine Dokumentation, Seite 156.
Urheberrechtlich geschütztes Bildmaterial ist zu finden unter:
1. Bildnachweis, Das Zeughaus von Südosten. Klaus Frahm Hamburg. Veröffentlich in Preußen Kunst und Architektur, Seite 95.
2. Bildnachweis, Linienschiff „Kurfürst Friedrich Wilhelm,“ veröffentlicht unter www.german-navy.de.
3. Weitere Bildhinweise über Hermann Lorey sind im Digitalisierungszentrum München zu finden.
1. Anmerkung
Recherchen im Bundesarchiv Freiburg durch den Sohn des Autors haben ergeben, das dort wenig aussagefähige Dokumente über den Bereich Heeresmuseen vorliegen. Hier die wichtigsten, nicht im Text mit eingearbeiteten Hinweise.
Aus Briefen des OKH ist zu entnehmen das die Heeresmuseen nicht den Wehrkreiskommandos sondern dem OKH direkt unterstellt waren. Es existieren Briefe an die Heeresmuseen Königsberg/Straßburg, die das bestätigen und von Oberst Faasch, bzw. General von Wedel unterzeichnet sind. (RH62/v.105 N4271/44, Befehl vom 20.7.44). Es existiert ein Brief vom 11.08.1942 an Herrn General Roese/Chef der Heeresmuseen in Berlin, W/35 Blumenhof 17 von Oberst Pühringen, Generaldirektor der Oberpreußischen Museen. (RH 62/v.2). Die Unterlagen zu den Heeresmuseen Königsberg/Straßburg sind wenig aussagefähig. Bei Königsberg geht es in erster Linie um Briefe bis 1940 und einige Denkschriften eines Hauptmann Sommer aus 1958/60. Bei Straßburg sind es Briefe, die eine Verlagerung nach Rothenburg an Der Tauber beinhalten.
Alle vorhandenen Unterlagen wurden 1945 in einem Dokumentenzug von den Amerikanern erbeutet und komplett in die USA transportiert. Ab 1958 wurden die Unterlagen zurückgegeben. Bleibt die Frage offen, ob sie zu dem Zeitpunkt noch vollständig waren? Erstaunenswert ist, dass die Unterlagen zum Museum in Königsberg ca. 1940 enden. (RH62/V112 und RH 62 V113).
2. Anmerkung
Über den Rittmeister der Reserve Ernstotto Graf Solms zu Laubach gibt es im Personenarchiv der Wehrmacht keine Angaben im Bereich der Offiziere. Um festzustellen, ob Ernstotto Graf Solms zu Laubach in eine Einheit geschlüsselt war, müsste man wissen, welchem Stab er zugeordnet war, bzw. ob er direkt unterstellt war.
3. Anmerkung
Zu General Roese gibt es einen Hinweis, obwohl aus diesem keine Tätigkeit als Chef der Heeresmuseen hervorgeht. General Roese wurde am 21.10.1879 in Eisenach geboren und war bis 1938 als aktiver Offizier in verschiedenen Dienststellungen des Heeres /Infanterie eingesetzt.
Aus den vorhandenen Briefen geht ein ständiger Streit zwischen OKH/ Reichspropagandaministerium und Heeresmuseen hervor, wer wem wann etwas zu befehlen hat.
4. Anmerkung
Lorey war nach dem Krieg wieder im Rahmen der Staatlichen Museen tätig. Darüber berichtet Irene Kühnel - Kunze im Teilabschnitt „ Der Magistrat von Berlin übernimmt die ehemals Staatlichen Museen. Substanzerhaltung und Beginn neuer Tätigkeiten“ , folgendes:
„ Eine vom 12. Oktober 1945 datierte Liste der Abteilungsleiter und deren Stellvertreter verzeichnet 18 Namen: Andrae, Anthes, Blümel, Brittner, Klar, Koch, Kühnel, Kühnel-Kunze, Lorey , Möhle, Post, Rave, Schmidt, Stief, Suhle, Weickert, Winkler und Zimmermann.“ Unter diesen genannten Abteilungsleitern bzw. deren Stellvertretern gab es zwei Personen, die auf jeden Fall Berührungspunkte zum Bernsteinzimmer hatten: Lorey und Zimmermann. Zimmermann war Direktor des Kaiser Friedrich Museums mit dem Alfred Rohde über das Bernsteinzimmer korrespondierte. (Hervorhebung durch den Autor.)
5. Anmerkung
Lorey wurde 1946 zur wissenschaftlichen Arbeit in den Berliner Museen herangezogen die von russischer Seite ausging.
„ Von russischer Seite wurde im Dezember 1945 der Plan eines umfassenden Werkes über Museologie an den Magistrat (Berlin)herangetragen an dem sich möglichst viele der anwesenden Wissenschaftler der Museen und zwar der Kunstmuseen wie der naturkundlichen beteiligen sollten...
Es beteiligten sich folgende Museumsangehörige:
Andrae, Weickert, Suhle, Kühnel, Lorey , Post, Rave, Koch, Kautzsch, Möhle...“ u.a. (Hervorhebung durch den Autor)
Kühnel-Kunze, Irene: Bergung – Evakuierung - Rückführung. Die Berliner Museen in den Jahren 1939-1959. Abschnitt IV Neue Verwaltungen (nach dem 8. Mai 1945), Seite 76 und Seite 83
6. Anmerkung
In der Handreichung zur Umsetzung der Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz vom Dezember 1999, werden Ernstotto Graf Solms zu Laubach und Georg Poensgen „ als Referenten für den militärischen Kunstschutz für die Militärverwaltung Osten“ geführt.
(Handreichung 1999 Seite 18)
7. Anmerkung
Literatur: Zwach, Eva, Deutsche und englische Militärmuseen im 20. Jahrhundert. Museen – Geschichte und Gegenwart. Band 4. Münster 1999.
8. Anmerkung
Nach dem Krieg werden die wichtigsten Akten des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg im Centrum de Documentation Juive Contemporaine in Paris und in den Zentralarchiven in Kiew und Riga sowie in Spezialarchiven in Moskau aufbewahrt .
In den Spezialarchiven sind die vom ERR geführten Karteikarten über sichergestellte Kunstgüter vorhanden. Für die Öffentlichkeit sind diese Karten gegenwärtig noch nicht einsehbar. Kulturelle Werte wurden durch militärische Einheiten erfasst. Bei der Durchführung dieser Aufgaben standen die Chefs der Heeresarchive, der Heeresbibliotheken und der Heeresmuseen an erster Stelle. Diese Erfassungskriterien befinden sich gegenwärtig ebenfalls in Spezialarchiven in Moskau.
Читать дальше