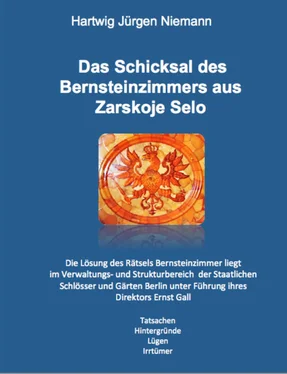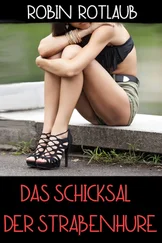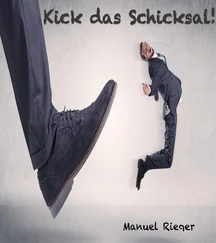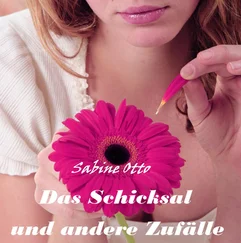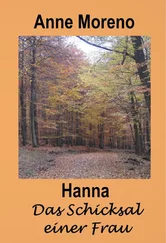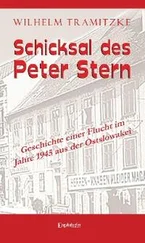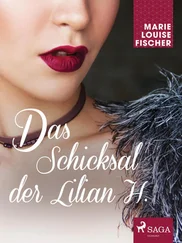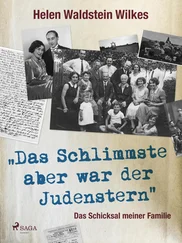Die Mosaiktafel in der Mitte stellt das Gehör vor, ebenfalls eine italienische Bauerngruppe unter Ruinen.“ (3)
Der Direktor der Städtischen Kunstsammlung Königsberg Alfred Rohde, der sich auf eigene Beobachtungen berufen kann, nachdem sich das Bernsteinzimmer im Königsberger Schloss befand, veröffentlichte folgende Einschätzung über den Rahmen Friedrich des Großen:
„ Bei den breiteren Wandfeldern, sind die Spiegel, die die Mitte der Felder zierten, von Rastrelli entfernt worden und an ihrer Stelle große Rahmenfelder mit eingesetzten Steinmosaikbildern verwendet worden.
Anregung zu diesen Rokokofeldern gab ein großer, heute leider sehr zerstörter Spiegelrahmen, den Friedrich der Große 1745 der Kaiserin Elisabeth schenkte und der in die linke Seitenwand eingebaut ist.
Nach ihm wurden wohl die drei anderen Rahmenstücke gearbeitet.
In alle 4 Rahmenstücke wurden italienische (toskanische) Steinmosaikbilder, die vier Sinne darstellend, eingesetzt.“ (4)
Die Einschätzung Rohdes: „... heute leider sehr zerstörter Spiegelrahmen, den Friedrich der Große 1745 der Kaiserin Elisabeth schenkte...“ deutet daraufhin, dass dieser Spiegelrahmen mit nach Königsberg gekommen ist.
Auf einer Aufnahme aus dem Jahre 1917 ist der Rahmen Friedrich des Großen in der Südwand zu sehen. Die Bestimmung Südwand wird auf dieser Fotografie möglich durch das Mosaik vom Tast- und Geruchssinn. Hier gibt es auf jeden Fall eine Übereinstimmung mit der Beschreibung aus dem Auswärtigen Amt von 1882.
Zusammenfassend kann die Feststellung erfolgen, dass es zwei unterschiedliche Hinweise über die Anbringung des Rahmens gibt.
1. Nach von Köhne in der Ostwand, rechts von der Tür mit dem Steinmosaik vom „Geschmack“.
2. Nach der Aufnahme aus dem Jahre 1917 in der Südwand, mit dem Mosaik vom „ Tast- und Geruchssinn“. Hier gibt es eine Übereinstimmung mit der Feststellung Alfred Rohdes und mit dem rekonstruierten Bernsteinzimmer aus dem Jahre 2003.
______________
1.von Köhne, Seite 104.
2. von Köhne, Seite 109 -110.
3.von Köhne Seite 110.
4. Rohde, Pantheon, Seite 203.
Urheberrechtlich geschützte Bildnachweise sind zu finden unter:
1.
Die Ostwand in Zarskoje Selo. Aufnahme aus dem Jahre 1917. Jantarnaja komnata. Autoren Woronow und Kutschumow. Russische Ausgabe.
2.
Die Südwand mit dem Mosaik vom „Tast- und Geruchssinn“, Aufnahme aus dem Jahr 1917. Jantarnaja komnata. Autoren: Woronow u. Kutschumow. Russische Ausgabe.
3.
Zerstört - Entführt – Verschollen. Die Verluste der Preußischen Schlösser im Zweiten Weltkrieg. Gemälde I, Seite 135. Potsdam 2004. GKI 966
Georg Dawe. Kaiserin Elisabeth von Rußland. Leinwand, 87 x 69 cm. Am 14. Mai 1827 für 433 Taler erworben und im Berliner Schloss platziert. 1883 dort inventarisiert. 1909 im Gemäldevorrat Schloss Schönhausen. 1911 in das Schloss Charlottenburg. Zeitweilig im Hohenzollernmuseum Schloss Monbijou.
4.
Zerstört – Entführt – Verschollen. Die Verluste der Preußischen Schlösser im Zweiten Weltkrieg, Gemälde I, Seite 484. Potsdam 2004. GKI 11894 Anna Dorothea Therbusch, geb. Lisiewska. Friedrich der Große. Leinwand, 52,5 x 44,5 cm. Neues Palais – Schloss Babelsberg (?) – Juni 1944 Kloster Lehnin jetzt als Kriegsbeute im Staatlichen Puschkinmuseum, Moskau ( am 10. Oktober 1946 dort registriert).
5.
Details aus dem Rahmen Friedrich des Großen im Vergleich mit den Ausführungen aus dem Auswärtigen Amt Russlands (von Köhne), veröffentlicht in Jantarnaja komnata, St. Petersburg 2003, Autorenkollektiv.
Die Computerbearbeitung erfolgte durch den Autor. Die Bilder befinden sich im
Privatarchiv des Autors.
Der Chef der Heeresmuseen erteilt einen Auftrag
Als im Jahre 1934 der den Nationalsozialisten unbequem gewordene Kunsthistoriker und Direktor des Berliner Zeughauses Moritz Julius Binder abgelöst wurde, übernahm Konteradmiral a.D. Hermann Lorey in der Zeit vom 1. Aug. 1934 – Mai 1945 als Direktor die Verantwortung für das Zeughaus in Berlin. Damit erhielt das Zeughaus wieder einen Militär außer Dienst als Direktor.
Gleichzeitig wurde im Jahr 1934 dieses Objekt dem Reichs- und preußischen Ministerium für Wissenschaft- Erziehung und Volksbildung, verantwortlicher Minister Bernhard Rust, einem Freund Hitlers unterstellt. Es war das gleiche Ministerium, dem die Verwaltung Staatliche Schlösser und Gärten Berlin unterstellt wurde.
Lorey hatte bis „1925 aktiv in der Marine“ gedient. Zur Kaiserzeit bewährte sich Hermann Lorey als Kommandant des Linienschiffes „S.M.S. Kurfürst Friedrich Wilhelm“. Im Juli 1900 wurde das Schiff gemeinsam mit anderen Schiffen als „Ostasiatisches Expeditionskorps“ zur Niederschlagung des Boxeraufstandes nach China entsandt ohne dort irgendwelche kriegerischen Handlungen zu unternehmen. Mitte August 1901 erreicht das Linienschiff wieder den deutschen Heimathafen Kiel.
Ab 1907 versah „S.M.S. Kurfürst Friedrich Wilhelm“ seinen Dienst in der Reserveformation der Nordsee. 1910 wurde das Schiff für 9 Millionen Mark an das Osmanische Reich verkauft. Dort lief es unter den Namen: „Heireddin Barbarossa“ ( „Barbaros Hayreddin“ ).
Im Ersten Weltkrieg fuhr „Heireddin Barbarossa“ unter dem deutschen Kommandanten Hermann Lorey (1877-1954). Das Schiff wurde am 8. August 1915 durch das britische U-Boot E 11 versenkt. 253 türkische und deutsche Besatzungsmitglieder überlebten den Angriff nicht.
Hermann Lorey erlebte die Zeit des Kolonialkrieges und den Ersten Weltkrieg. Er stieg die maritime Leiter bis zum Vizeadmiral empor. Dass er ein mutiger, dem Kaiser treu ergebender Offizier war, beweisen die ihm verliehenen türkischen und deutschen Auszeichnungen:
Kaiserlich Türkische Osmanie-Orden 4.Kl.,
Preußischer Roter Adler-Orden 4.Kl.,
EK 2,
EK I,
Dienstauszeichnungskreuz.
Im Zweiten Weltkrieg konnte Lorey sich erneut bewähren, zwar nicht als Kommandant eines Linienschiffes, aber als vorübergehender Chef der Heeresmuseen und Direktor des Zeughauses in Berlin.
Nun ging es darum ehemalige deutsche Kunstgüter ins Dritte Reich zurückzuholen. Hermann Lorey war dabei. Gewissenhaft erfüllte er die Wünsche seines Führers, nicht nur in Frankreich sondern mit der gleichen Akribie in der Sowjetunion.
Hermann Lorey war Offizier des Kaisers. Er gehörte im Dritten Reich zu den Offizieren die als kaisertreu eingeschätzt werden können. Er reiht sich damit ein in die Reihe der kaisertreuen Offiziere aus dem Infanterieregiment 9, die während des Krieges maßgeblich daran beteiligt waren, ehemalige Kunstgüter der Hohenzollern in Sicherheit zu bringen. Seine Treue zu den Hohenzollern kann ihn mit bewogen haben an Ernstotto Graf Solms und Gerhard Poensgen den Auftrag zu erteilen, das Bernsteinzimmer in Sicherheit zu bringen.
Für „ die Sammlung der Kriegsmarine im Museum für Heereskunde in Berlin, blieb er auch nach 1934 Direktor .“ (1)
Mit Beginn des Krieges gegen Frankreich übernahm dieser reaktivierte Offizier die Aufgaben des Chefs der Heeresmuseen.
Admiral Lorey war in dieser Funktion verantwortlich für Trophäen und Kriegsbeute sowie deren Erfassung und Verteilung. Damit war er stellvertretend bis zum 1. Mai 1942 in einer Funktion tätig, die vom 1.5.1938 bis zum Kriegsbeginn der General der Infanterie Friedrich Roese, wahrgenommen hatte.
Konteradmiral a.D. Hermann Lorey trug die volle Verantwortung für das „Einsammeln“ des Bernsteinzimmers in Zarskoje Selo. Daran gibt es keinerlei Zweifel. Lorey war der Auslöser. Er gab das Signal zum Handeln.
Читать дальше