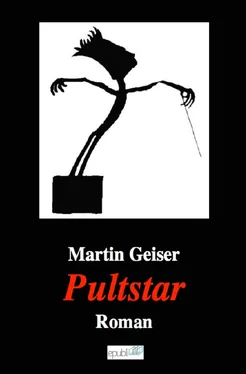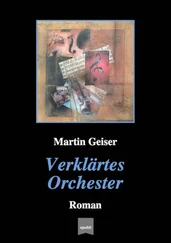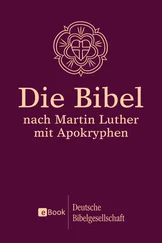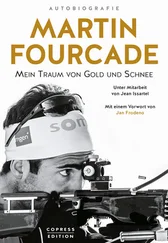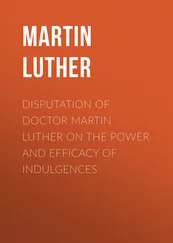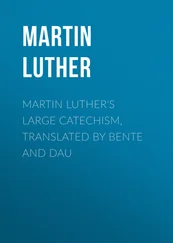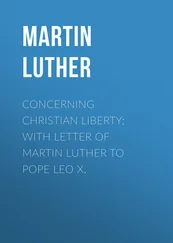Die Monate in Wien, wo ich das Dirigentendiplom bei Gregor von Borowski erwarb, waren eine Zeit voller Demütigungen und Erniedrigungen. Ich mag mich nicht erinnern, so viele Tränen vergossen zu haben, wie während meines Studiums in der Donaustadt. Von Borowski war ein verhinderter Dirigent, dem es nie zum Durchbruch gereicht hatte und der seinen Unmut darüber tagtäglich an seinen Studenten ausließ. Außerdem hatte er Vaters Aufstieg mit viel Missgunst und Neid mitverfolgt und war ein erklärter Gegner seiner musikalischen Vorstellungen.
»Oberflächlich, ohne Ecken und Kanten, alles auf Hochglanz poliert ohne in die musikalischen Tiefen vorzudringen.«
Das waren noch die höflicheren Urteile, die er über Vater fällte und verkündete. Er warf ihm – und das nicht zu Unrecht – sein autoritäres Auftreten vor, das er selbst in seinen Klassen aber auch an den Tag legte und das, so wie ich ihn einschätzte, wohl auch seine Art der Orchesterleitung gewesen wäre, wenn er die Möglichkeit dazu gekriegt hätte.
So war ich für ihn natürlich ein dankbares Opfer, dem gegenüber er seine Aversion gegen Victor Steinmann ausleben konnte.
Sein Fachwissen war unbestritten enorm, doch konnte er mir bei der Partituranalyse wenig Bedeutendes beibringen, worauf mich nicht schon Vater in früherer Zeit hingewiesen hätte.
Ich ließ mich geduldig von ihm unterweisen, doch er bemerkte ziemlich rasch, dass er mir, was das theoretische Wissen anbelangt, nicht mehr viel beibringen konnte, und die Tatsache, dass er wusste, woher ich mir meine Kenntnisse angeeignet hatte, brachte ihn umso mehr auf die Palme.
Und so arbeitete er mit aller Kraft daran, meine Schwächen, nämlich die Arbeit mit dem Orchester, in aller Öffentlichkeit bloß zu stellen. Er war ein kleiner, dürrer Mann mit Glatze, Kinnbart und Hornbrille und reichte mir knapp bis zu meinen Schultern. Wenn ich auf dem Podest stand, war ich fast zwei Köpfe grösser als er, sodass er, wenn er mich zurechtweisen wollte, mich zwang neben das Podest zu stehen und selber darauf stieg, um mit mir etwa auf Augenhöhe zu sein.
»Steinmann«, feixte er, »schließen Sie Ihren Mund. Sie sind kein Sänger, sie wollen Dirigent werden. Also machen Sie gefälligst, was ein Dirigent zu tun hat: Zeigen Sie, was Sie haben wollen. Und sparen Sie sich Ihre ausladenden Gesten. Deutlich, zweckmäßig und präzis sollen sie sein, sonst können Sie sich genauso gut der Schauspielerei widmen.«
Und immer dazu das Flackern in seinen Augen, das ich noch heute deutlich vor mir sehe, dieser Hohn, der mir suggerieren sollte, dass ich nie zustande bringen werde, was der von ihm verhasste Victor Steinmann so vorzüglich zu leisten in der Lage ist.
Nein, es war keine schöne Zeit für mich, damals in Wien.
Es ist eine Station in meinem Leben, die mir als dunkler Fleck in Erinnerung bleibt, die sich wie ein Pfeil in mein Herz bohrt, wenn ich an sie zurückdenke.
Und das Schlimmste am Ganzen ist, dass all diese Erniedrigungen, die ich in Kauf nahm, mich eher von Vater weggetrieben als mich mit ihm zusammengeführt hatten, so wie ich mir das eigentlich erhofft hatte.
Wenn ich meine Aufzeichnungen überfliege, die ich seither gemacht habe, breitet sich in mir Entsetzen aus. Habe ich das tatsächlich alles geschrieben? Ist das wirklich das Werk von einer einzigen Person, so wirr, so zusammenhangslos, ja, beinahe schizophren?
Und dann der nächste Gedanke: Wird das jemals jemand lesen? Bestimmt. Zumindest die Gendarmen, die mich finden werden, werden die Aufzeichnungen im Computer entdecken, sie ausdrucken und analysieren, vielleicht wird auch die Presse mit Auszügen bedient werden. Es soll doch die Weltöffentlichkeit erfahren, wie der Wahnsinnige denkt, der den großen Victor Steinmann umgebracht hat.
Doch eigentlich spielt das keine Rolle. Ich schreibe, weil ich sonst nichts anderes tun kann, weil ich hoffe, meine Gedanken etwas ordnen zu können, die Vergangenheit aufzuarbeiten, mir Gewissheit geben zu können, dass mein Handeln richtig war – für mich jedenfalls!
Sollen die Leser, die diese Niederschrift zu lesen bekommen, einen Einblick in mein Leben kriegen und selber zu einem Urteil kommen!
Ich werde nicht mehr da sein, werde die Stürme der Entrüstung nicht mehr mitbekommen. Seit ich hier unten in Südfrankreich bin, lese ich keine Zeitung, schaue nicht fern und surfe nicht im Internet. Ich weiß nicht, was über Vaters Tod geschrieben wird, habe keine Ahnung, ob die Polizei schon eine Spur hat. Gewiss wird man nach dem Sohn suchen, man wird sich fragen, wo er sich aufhält und warum er sich nicht meldet. Natürlich bin ich verdächtig für sie und eigentlich staune ich schon, dass Vaters Ferienhaus in Gigaro noch nicht durchsucht worden ist.
Es ist mir egal. Für mich gibt es kein Hier und Jetzt, nur die Gedanken an das Vergangene, an zerronnenes Glück und an grenzenlose Wut sind gegenwärtig.
Die Hilflosigkeit, nichts mehr ändern zu können und trotzdem die ständig herumschwirrende und mich quälende Frage, wo eine alternative Entscheidung meinem Leben eine andere Richtung hätte geben können. Die Selbstzweifel und das Bewusstsein, keine andere Wahl gehabt zu haben, mein Schicksal zu beeinflussen, überwältigen mich regelmäßig wie ein mächtiger und todbringender Tsunami.
Meine Aufzeichnungen – kein großer Bogen, keine Symphonie, nur Vater und ich. Ich und Vater. Variationen, wenn man so will, über ein einziges Thema: Musik.
Nun bin ich hier in Gigaro, alleine mit der Musik. Ohne Unterbruch kommen Erinnerungen hoch, die ich mit der Musik assoziiere. Erlebnisse, die mit gewissen Melodien und Rhythmen verknüpft sind.
So wie jetzt.
Ich habe Beethovens drittes Klavierkonzert aufgelegt – eines meiner liebsten –, und die Erinnerungen stürzen auf mich hernieder, unerbittlich und mit einer grausamen Klarheit, obschon sie viele Jahre zurückliegen. Es war eine Zeit, in der mir das Klavier als Ausdrucksmittel noch genügte und ich noch nicht zum Taktstock gegriffen hatte. Also kurz vor meinen unseligen Studien in Wien.
Und es war eine Aufführung, die mir besonders gut im Gedächtnis geblieben ist, weil ich sie, auch heute noch, als außerordentlich gelungen betrachte.
Die Erinnerungen laufen in mir ab wie ein Film. Ich sehe mich in der Solistengarderobe sitzen, warte auf meinen Auftritt, warte auf Chris.
»Bist Du bereit?«
Ich sah zu Chris hoch. Die Enden seines Fracks hingen wie verwelkte Blätter einer Tulpe hinunter. Seine Stirn war feucht, und der Taktstock in seiner Rechten zitterte. Er hatte wieder getrunken.
Chris musste vor jedem Auftritt trinken, sonst konnte er nicht vor das Publikum treten, vor dieses garstige Ungeheuer, das jeden Abend wieder seine Zunge durch die Zähne gleiten ließ um dann entweder den Dirigenten zu verspeisen oder sich durch die Musik einlullen zu lassen.
Man wusste, dass Chris trank. Jeder wusste es. Die Kritiker, das Publikum, die Musikkollegen, schlichtweg jeder. Aber das machte nichts, denn man schaute großzügig darüber hinweg und meinte, die Genialität von Chris fordere ihren Tribut – auch wenn es sich dabei um Alkohol handle.
Es gab diverse Anekdoten über ihn; die meisten waren leider wahr. So zum Beispiel, dass er einmal so besoffen gewesen sei, dass er keinen einzigen Einsatz korrekt geben konnte und ihm schließlich im zweiten Satz von Brahms’ zweiter Symphonie der Stock aus der Hand gefallen sei. Als er sich gebückt habe um ihn wieder aufzuheben, sei er vom Podest gefallen und benommen liegen geblieben.
Andere Zungen behaupteten – und hier weiß ich nicht, ob dies tatsächlich wahr ist –, dass er aufs Podest gestiegen sei, gewartet habe, bis die Klatscherei aufhörte, das Stäbchen gehoben, sich dann umgedreht und in den Saal gerufen habe: »Ihr seid doch alles Pisser!« Darauf habe er noch gerülpst, und damit sei er dann von der Bühne verschwunden und nicht wieder erschienen.
Читать дальше