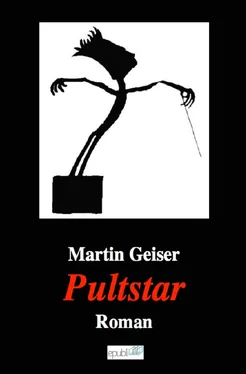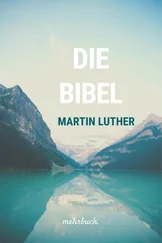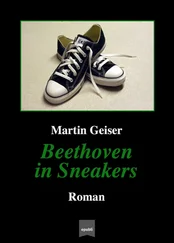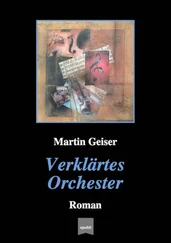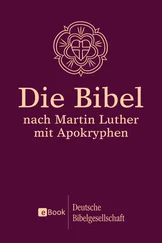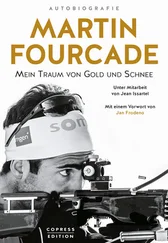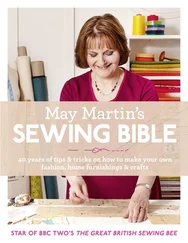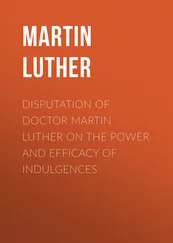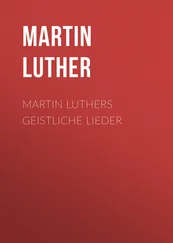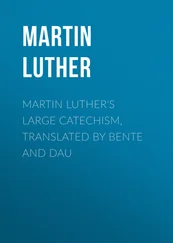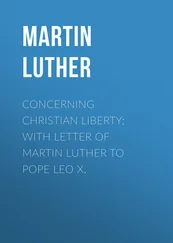So tat er den Beischlaf mit Charlotte als etwas unglücklichen Start ab, als entscheidend empfand er die Erkenntnis, wie einfach es ihm doch gefallen war, sie ins Bett zu kriegen und dass dies doch mit anderen Frauen auch möglich sein müsse. Es musste ja nicht immer so dramatische Begleiterscheinungen geben, wie das mit Charlotte der Fall gewesen war. Die Wilde Lena hatte ihm das mit ihrer sexuell offenen Haltung deutlich gezeigt.
Allerdings ließ er dabei außer Acht, dass Helene Weber die Männer, mit denen sie schlief, liebte und ihre Sexualität frei auslebte, ohne damit jemandem wissentlich schaden zu wollen oder ihn gar zu verletzen oder zu demütigen.
Victor Steinmann dagegen hatte mit der traurigen Behandlung von Charlotte Arnold den ersten Schritt zu seiner misanthropischen Lebenseinstellung gemacht.
*
Es ging mit seiner Karriere nicht gerade kometenhaft aufwärts, aber immerhin erarbeitete sich Victor in der Schweiz einen hohen Bekanntheitsgrad und erste kleinere Engagements aus dem Ausland ließen nicht auf sich warten. Die Kritiken waren meistens wohlwollend und wer den jungen Dirigenten einmal auf dem Podest hatte erleben dürfen, sprach nicht selten von einem »Dämon im Frack« oder von dem »feurigen und elektrisierenden Blick«, mit dem er das Orchester mitzureißen vermochte.
Hans Heinrich Baumberger konnte ihm Engagements in kleinen Städten vermitteln, meistens in Deutschland oder Österreich, und investierte viel Zeit in Gespräche mit Victor, in denen er den jungen Musiker besänftigen und wieder auf den Boden der Realität zurückholen musste. Dieser beklagte sich ständig über inkompetente Orchestermusiker, eitle Solisten und unsorgfältig zusammengestellte Konzertprogramme.
»Es ist, wie es ist, Herr Steinmann«, sagte Baumberger. »Das sind Ihre Lehr- und Wanderjahre. Sie müssen sich ein Repertoire aneignen und Ihre Erfahrungen machen. Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn es nicht so steil aufwärts geht, wie Sie das vielleicht möchten. Glauben Sie mir, es wird schon noch die Zeit kommen, in der Sie die Solisten auswählen und die Konzertprogramme bestimmen können.«
»Er hat recht, Victor«, besänftigte Professor Glauser seinen ehemaligen Schützling bei ihren zahlreichen Telefongesprächen. »Sie haben sich in der Musikwelt bereits einen Namen gemacht, man kennt Sie.«
»Wer ist man?« , frotzelte Victor auf solche Aufbauversuche. »Sie können sich nicht vorstellen, mit welchen Banausen ich es hier zu tun habe.«
»Victor«, seufzte Glauser, »ein bisschen mehr Bescheidenheit und Demut würden Ihnen ganz gut zu Gesichte stehen!«
»Es ist doch wahr!«, konterte Victor. »Am schlimmsten ist es in der Oper. Viert- oder fünftklassige Sänger – können die überhaupt Noten lesen? Und dann die Akustik in diesen Häusern – grauenhaft! Und als Sahnehäubchen muss ich mich mit Regisseuren herumschlagen, welche die Sänger kreuz und quer über die Bühne marschieren lassen, sodass man ihren Gesang gar nicht mehr hören kann. Wenn ich mir irgendeinmal meine Auftritte selber auswählen kann, so werde ich wohl einen weiten Bogen um die Oper machen.«
»Machen Sie das, Victor, machen Sie das. Aber bis es soweit ist, werden auch Sie sich im Orchestergraben behaupten müssen.«
In der Tat sollte Victor Steinmann nach seinem endgültigen Durchbruch nur noch vereinzelt Opern dirigieren, um sie schließlich völlig zu umgehen. Dafür setzte er häufig konzertante Aufführungen der großen Opernwerke aufs Programm, bei denen sich die Sängerinnen und Sänger nicht bewegen mussten und somit die akustische Perfektion gewährleistet werden konnte.
Vorläufig musste er sich allerdings, wie es sich für einen jungen Kapellmeister ziemte, mehr mit dem Musiktheater zufrieden geben und somit in den Tiefen des Orchestergrabens seine Präsenz ausleben, während Auftritte auf dem Podium mit einem symphonischen Programm eher zur Seltenheit gehörten.
Als er im Theater von Heidelberg Franz Lehárs Lustige Witwe leitete, erreichte ihn die Nachricht von Krisztina Szábos Ableben.
Seine ehemalige Klavierlehrerin war wohl einem Herzversagen erlegen; einer ihrer Schüler fand sie am Vormittag, nachdem sie ihm die Türe nicht geöffnet hatte, in ihrem Ohrensessel, in dem sie saß, wenn sie ihren Schülern aufmerksam und entspannt zuhörte – was bekanntlich durch ihre lebendige Art ja selten der Fall gewesen war.
Der Schüler rannte schreiend aus der Wohnung, nachdem er festgestellt hatte, dass seine Lehrerin nicht bloß schlief, und ein Nachbar rief schließlich einen Krankenwagen. Die Sanitäter stellten nicht bloß den Tod der großen Klavierpädagogin fest, sie mussten sich auch noch um den zehnjährigen Jungen kümmern, der zusammengebrochen war und aus diesem Erlebnis traumatische Folgeschäden erleiden sollte.
In Krisztina Szábos Schoss fand man eine Biografie über Richard Wagner, und es ist bis heute nicht geklärt, was die gebürtige Ungarin dazu gebracht haben könnte, sich mit dem Meister aus Bayreuth, den sie so abgrundtief ablehnte, wieder zu versöhnen – wenn sie es denn überhaupt getan hatte. Vielleicht hatte ihre Liebe zu seiner großartigen Musik seinen politischen Einstellungen gegenüber Überhand gewonnen, man wusste es nicht so genau.
Möglich wäre aber auch, dass sie sich bei der Lektüre seines Lebens so maßlos aufgeregt hatte, dass ihr Herz den Dienst versagte und sie somit indirekt von Wagner – dem alten Nazi, wie sie ihn nannte – in den Tod getrieben worden war – ein solch melodramatisches Ende hätte zu ihrem verflossenen Leben gut gepasst.
Victor war es durch sein Engagement in Heidelberg nicht möglich, an der Trauerfeier teilzunehmen, und so setzte er sich an diesem Tag ins Dirigentenzimmer des Theaters und spielte auf dem Klavier – in Memoriam an Krisztina Szábo – die Nocturnes von Frédéric Chopin, die sie so sehr gemocht hatte, besonders das zweite Stück in Es-Dur, das er demzufolge sogar wiederholte.
Als der letzte Ton verklungen war, saß er lange bewegungslos und mit geschlossenen Augen vor dem Instrument, wobei er sich die vielen Begegnungen mit seiner Klavierlehrerin in Erinnerung rief. Er sah sie vor sich, wie sie ihm eindringlich erklärte, wie das Pedal bei ihrem Lieblingsnocturne von Chopin, das er vorher zweimal gespielt hatte, einzusetzen sei. Er erinnerte sich, wie sie sich mit übertriebener Abscheu auf Alfred Hitchcocks Psycho vor dem Kino eine Zigarette angezündet hatte. Und er fühlte ihre spontanen Berührungen und ihre Küsse, wenn sie ihm gratuliert hatte, sich für ihn freute und ihn mit einem schelmischen Lächeln Professor genannt hatte – die Anrede, die sie für alle großen Musiker zu benutzt hatte.
Nun war sie tot, und mit ihr hatte er eine Vertraute verloren, die immer ein offenes Ohr für ihn gehabt und ihn in den kritischen Momenten aufgebaut und beraten hatte – immer mit einer positiven Lebenseinstellung, auch wenn diese hinter ihren melodramatischen Gesten und ihrer manchmal plakativ gespielten Empörung nicht immer deutlich festzustellen gewesen war.
Victor öffnete die Augen und legte die Hände auf die Tasten, allerdings ohne sie niederzudrücken. Mit einem grimmigen Lächeln wusste er plötzlich, was er zu tun hatte. Er setzte sich aufrecht vor das Klavier und begann mit seiner Transkription von Richard Wagners Tannhäuser-Ouvertüre , die er an der Vortragsübung gespielt hatte, an der Mademoiselle Szábo auch anwesend gewesen war und sich nicht getraut hatte, vor lauter Ehrfurcht vor der Kultur, ihren Platz demonstrativ zu verlassen.
Er griff in die Tasten und sang laut mit, denn er wusste, dass Krisztina Szábo irgendwo da oben sitzen, ihn beobachten und trotz allem – mit gespieltem Entsetzen – ihre unbändige Freude an Richard Wagners Musik haben würde.
Читать дальше