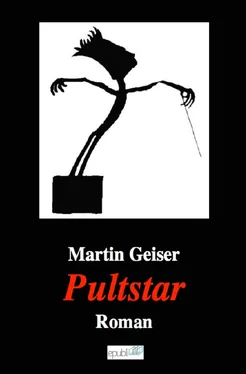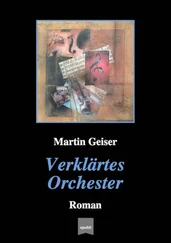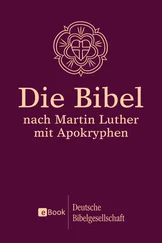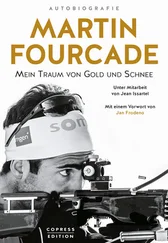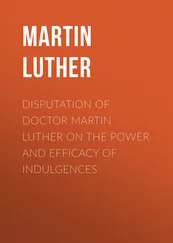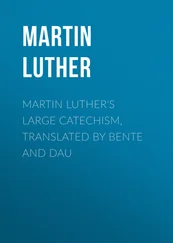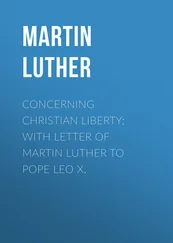Es war dieses Gefühl von Macht und Überlegenheit. Der Dirigent als Gott; ein Schöpfer, der von der Natur mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit ausgestattet worden ist, die nur den wenigsten Menschen in die Wiege gelegt wird.
Demut walten lassen, wenn man mit frenetischem Applaus belohnt wird. – Ich bin doch nur einer von euch.
Scheißt drauf – klatscht gefälligst, wegen mir seid ihr ja schließlich da, mich wollt ihr sehen – mein Gott, bin ich gut!
Ich habe meine Stereoanlage dirigiert, glaubte, alle wichtigen Werke auswendig zu kennen, habe alles durchgespielt, alles ausgelebt, habe meinem Vater nachgeeifert – und trotzdem war ich nicht mit jeder Faser meines Körpers überzeugt davon gewesen, Musiker werden zu wollen.
Ich kann mir vorstellen, dass dies für den Leser unverständlich klingen muss, doch habe ich immer wieder Zweifel in mir festgestellt und gefunden, dass es da noch irgendetwas geben müsse, eine andere Herausforderung, die das Leben für mich bereithält.
Ich vertiefte mich in psychologische Schriften, die ich seit meiner ersten literarischen Begegnung mit Sigmund Freud regelrecht verschlungen hatte, wusste nicht so recht, was ich damit anfangen konnte, stellte aber schlicht eine ungeheure Faszination für die Materie fest – Psychologie zu studieren stand damals ganz zuoberst auf meiner Wunschliste.
Was wäre mir doch alles offen gestanden, wenn ich diesen Weg eingeschlagen hätte! Ich hätte mich mit der Psychologie der Orchesterführung beschäftigen, angesehene und weltweit anerkannte Studien darüber verfassen und diese in einen Bestseller einfließen lassen können. Mein eigener „Klang der Macht“ sozusagen!
Daneben absolvierte ich fleißig meine Klavierstunden, war mir aber nicht sicher, ob dies wirklich meine Berufung sein könnte, übte aber ehrgeizig weiter, weil ich darin einen möglichen Weg zur Selbstverwirklichung sah. Ich habe die Musik von ganzem Herzen geliebt, und trotzdem – ich war mir noch nicht sicher. War es das wirklich? Wollte ich wirklich so werden wie Vater?
Dann geschah etwas Merkwürdiges: Ich sah im Fernsehen eine Dokumentation über Leonard Bernstein, wie er zusammen mit einem Orchester, das aus lauter jungen Musikern bestand, Schumanns zweite Symphonie probte – ergreifend und überwältigend. Und dann kam der entscheidende Moment: Am Ende der Sendung blickte der Maestro im rotem Pullover, bereits todkrank, in die Kamera. Die Worte fielen ihm schwer, ein heiseres und krächzendes Raunen – ich erinnere mich aber noch haargenau an die Sätze, die er nur an mich zu richten schien:
»Es gibt so viele Pianisten, Geiger, Solisten, Orchestermusiker, Sänger und Dirigenten, so dass man diese Berufe nur ergreifen sollte, wenn man sich dazu berufen fühlt. Schon wenn man sich die Frage stellt – Soll ich Musiker werden? –, dann muss die Antwort nein lauten, weil man die Frage überhaupt stellt.«
Wie elektrisiert setzte ich mich kerzengerade auf und sah plötzlich klar: Ich war auf dem falschen Weg, da ich mir ebendiese Fragen unaufhörlich immer wieder stellte.
Und trotzdem bin ich Musiker geworden, habe mich zum Konzertpianisten ausbilden lassen und danach das Handwerk des Dirigierens erlernt. Musik wurde für mich zu einem Zwang, zum einzigen Lebensinhalt – ausgelöst durch einen schicksalhaften Abend, auf den ich später noch zurückkommen muss.
Zurzeit ist das jedoch nicht das Thema, im Moment bin ich eins mit der Musik, tanze durch die Räume des Ferienhäuschens in Gigaro, stockbetrunken, die Musik voll aufgedreht. Mahlers Fünfte dröhnt durch das Haus, ich dirigiere mit, singe, lege den Kopf in den Nacken und drehe mich um die eigene Achse, bis mir schwindlig wird und ich zu Boden falle.
Benommen bleibe ich liegen, die Augen geschlossen und spüre die Übelkeit aufkommen. Mahler rast über mich hinweg. Ich schaffe es noch knapp ins Badezimmer, wo ich, vor dem Klosett kniend, mich übergeben muss. Als ich wieder erwache, sitze ich auf dem kalten, gefliesten Boden und zittere. Mein Magen scheint Purzelbäume zu schlagen. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen bin, die Musik ist jedenfalls verklungen. Also muss ich weit über eine Stunde hier im Badezimmer verbracht haben.
Ächzend versuche ich mich zu erheben, in meinem Kopf hämmern sämtliche Nibelungen auf ihre Ambosse, und ich höre die entsprechende Musik aus Wagners Rheingold. Als ich vor dem Spiegel stehe und mein armselig eingefallenes Gesicht betrachte, kann ich im linken Mundwinkel ein zynisches Lächeln feststellen: Selbst wenn es mir so beschissen geht wie in diesem Moment, so denke ich noch an Musik – sie ist allgegenwärtig, und ich kriege sie einfach nicht aus meinem Kopf.
Ich stütze mich auf das Waschbecken, suche im Spiegelschrank nach Aspirin und schlucke zwei Tabletten. Im Wohnzimmer lege ich mich aufs kühle Polster und ziehe eine Decke über mich. Noch immer dröhnt Wagner in meinem Kopf, ich stecke mir die Zeigefinger in die Ohren und dehne meine Nackenmuskeln, indem ich den Kopf langsam vor und zurück bewege. Es ist nicht zum Aushalten.
Ich brauche unbedingt ein paar Stunden Schlaf. Schließlich bin ich nicht hierher gefahren, um in den Tag hinein zu leben und mich zu besaufen. Ich habe ein Ziel, eine Mission, einen Auftrag. Ich muss es aufschreiben, und danach will ich zu einem Ende kommen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, bis sie mich finden werden.
Es ist erschreckend, wie einfach es ist, einen Menschen umzubringen. Ich spreche dabei nicht von der Tötung als solcher. Den Abzug der Pistole zu betätigen, das hat mir überhaupt keine Probleme bereitet. Eher hätte ich mit viel mehr äußeren Widrigkeiten und auch inneren Widerständen gerechnet, bis ich Vater schließlich gegenüberstünde und die Schüsse abgeben könnte. Ich war ja weiß Gott nicht der einzige Besucher seines Auftritts im Kultur Casino Bern. Im Gegenteil, das Konzert war ausverkauft, und somit musste ich mit jeder Menge Leute rechnen, die mir im wahrsten Sinne des Wortes bei meiner Tat im Weg stehen könnten. Im Nachhinein denke ich darüber nach, ob ich es mir nicht viel bequemer hätte machen können. Aber die Vorstellung, meinen Vater ganz einfach über den Haufen zu schießen, wenn er nach dem Konzert das Casino verlässt, enthielt für mich zu wenig Dramatik. Es hätte niemals zu seinem aufregenden Leben gepasst.
Die Tat war sorgfältig geplant, aber es gab in dieser Gleichung einen Haufen unbekannter Variablen, welche mir Probleme bereiten konnten.
Eines war mir aber von Anfang an klar: Nach der Tötung brauchte ich noch genügend Zeit, um nach Gigaro zu fahren und mich dort zu verstecken. Ich wusste, dass sie mich finden würden – früher oder später. Ich brauchte lediglich ein paar Tage, um meine Gedanken schriftlich festzuhalten, um der Nachwelt die Gründe für meine Tat darlegen zu können.
Durch meine Lektüre von Kriminalromanen wusste ich, dass der Gebrauch einer Kreditkarte Spuren hinterlassen und somit meinen Aufenthaltsort verraten könnte. So hob ich in den letzten paar Wochen regelmäßig Beträge von meinem Konto ab, um genug Bargeld zu besitzen. Ich entledigte mich auch meines Handys, zerstörte die SIM-Karte und warf das Gerät irgendwo in einen Abfallkorb.
Ich wollte es ihnen so schwer wie möglich machen, mich zu finden, damit ich ausreichend Zeit hätte, um zu schreiben und von dieser Welt Abschied zu nehmen.
Ich durfte nirgendwo Aufmerksamkeit auf mich ziehen. So absolvierte ich letzte Woche noch einen Auftritt mit einem drittklassigen Orchester in Kroatien, bei dem ich Ravels Konzert für die linke Hand spielte und welchen ich lieber abgesagt hätte, da ich unmöglich die Konzentration für diese Aufgabe finden konnte. Es gelang mir aber einigermaßen, meinen Fokus auf Ravel zu bündeln. So absolvierte ich meinen Auftritt ziemlich emotionslos und flog sofort in die Schweiz zurück, wo Vater in der kommenden Woche seinen großen Auftritt haben sollte.
Читать дальше