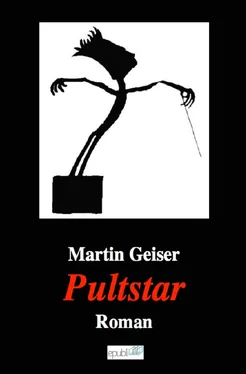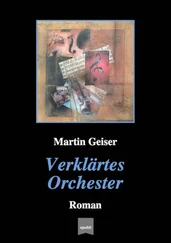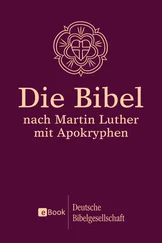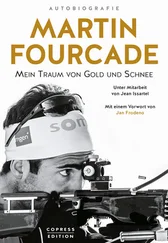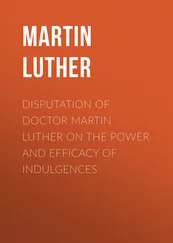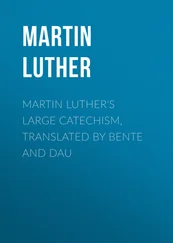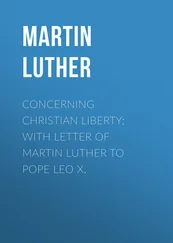»Was dachtest du?«, schrie sie ihn so an, dass beinahe die Wände zitterten. »Ich will dir sagen, was du gedacht hast, nämlich absolut nichts! Du hast dich steuern lassen von deinem ... Ding da zwischen den Beinen. Du hast alles zerstört, alle meine Träume an die Wand gefahren, unsere gemeinsame Zukunft vernichtet, bloß weil dir dein ... Ding da wichtiger war.«
»Charlotte«, hob Victor mit flehender Stimme an, »lass uns doch darüber reden.«
»Raus!«, brüllte sie und zeigte zur Türe. »Raus mit dir, Victor Steinmann, du großer Stardirigent. Meinst du, bloß weil dir das Publikum im Casino zu Füssen gelegen hat, könntest du plötzlich alles mit mir machen? Scher dich zum Teufel, du wirst dort draußen bestimmt eine Menge Frauen finden, die noch so gerne für dich die Beine breitmachen werden. Ich will dich nie mehr wieder sehen!«
Victor kroch auf allen Vieren ein wenig vorwärts und richtete sich dann mühsam auf. Er hielt sich am Bettgestell fest und prüfte, ob das Schwindelgefühl etwas nachgelassen hatte. Charlotte stand neben der Türe, die Arme verschränkt und beobachtete mit scharfem Blick jede seiner Bewegungen, so als ob sie einen Angriff von ihm erwarten würde, dem sie sich zur Wehr setzen müsste.
Er schüttelte den Kopf, schleppte sich zur Tür und blieb neben ihr stehen, überlegte sich, ob er noch etwas sagen sollte und unterließ es schließlich. Als er sie anschaute, blickte sie weg, wartete unbeweglich, bis er das Zimmer verlassen hatte und knallte die Türe hinter ihm zu.
Auf dem Breitenrainplatz stoppte er ein Taxi und ließ sich zu Helene Weber chauffieren, die ihm erstaunt die Türe öffnete, ungeschminkt und nur mit einem Bademantel bekleidet, welcher allerdings schon bald zu Boden fiel und ihm den Blick auf ihre üppigen Brüste freigab, an denen er sich sofort zu schaffen machte.
»Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie ...
Wem meine Musik sich verständlich macht, der muss frei werden
von all dem Elend, womit sich die andern schleppen.«
Ludwig van Beethoven
»Also würden Sie mir nicht zustimmen, wenn ich behaupte, dass das Publikum in Ihre Konzerte kommt, um Victor Steinmann zu sehen?«
»Es liegt mir fern, dies zu beurteilen. Ich mache lediglich meine Arbeit. Aber schauen Sie, geht das Publikum nicht in ein Konzert um Musik zu hören ?«
Der Alkoholpegel steigt, meine Einbildungskraft nimmt kuriose und ausschweifende Formen an. Ich denke mir aus, vor dem Beginn eines Konzerts zu stehen.
Langsam und bedächtig setze ich einen Fuß vor den anderen und gehe die Treppe hoch. Ich lasse mir die wichtigsten Stellen des Werks noch einmal durch den Kopf gehen und bin dabei so in Gedanken versunken, dass ich beinahe gestolpert wäre. Ich halte für einen kurzen Moment inne, atme tief durch, zupfe meine imaginären Manschettenknöpfe zurecht und richte die nicht vorhandenen Fliege. Ich schüttle mit einem Lächeln den Kopf und mache mich daran, die letzten Stufen zurückzulegen.
Stopp, jetzt brauche ich wieder einen Schluck Wodka. Ich setze die Flaschenöffnung an meinen Mund und gönne mir einen kräftigen Schluck. Schwankend halte ich mich am Treppengeländer fest und schließe die Augen. Zurück in meine Fantasiewelt.
Im Saal sitzen Hunderte von Leuten, die bereits ungeduldig den Maestro erwarteten, um sich endlich den ersten Takten von Gustav Mahlers fünfter Symphonie hinzugeben. Die letzten Stufen sind erklommen, vor mir liegt noch ein langer Korridor, an dessen Ende sich die Tür befindet, durch die ich in die Welt der Schwerelosigkeit gelange – in den Konzertsaal. Ich beschleunige meine Schritte nicht, sondern lege die letzten paar Meter genauso bedächtig zurück, wie ich die Treppe hinaufgestiegen bin, bevor mich ein leichtes Stolpern fast aus der Bahn geworfen hat. Wie von unsichtbarer Hand wird die Türe aufgerissen, und für einen Augenblick werde ich vom hellen Scheinwerferlicht geblendet.
Ich betrete das Podest, Beifall ertönt. Zuerst zögernd, dann beinahe fanatisch. Ich schüttle dem Konzertmeister – oder ist es etwa eine Konzertmeisterin – die Hand und flüstere ihm etwas zu.
Dann drehe ich mich zum Publikum, verbeuge mich kurz, wende mich dem Orchester zu und blicke auf den Boden. Der Applaus ist verstummt, vereinzeltes Räuspern ist zu hören, einige blättern noch in den Programmen und suchen wohl nach der richtigen Satzbezeichnung. So stehe ich da und warte. Ich habe Zeit und bleibe unbeweglich stehen, bis auch das letzte Geräusch im Konzertsaal verhallt ist und man eine Stecknadel auf den Boden fallen hören könnte.
Dann hebe ich meinen Stab, lasse das Ende durch meine Hand gleiten und schaue ins Orchester, das heißt dorthin, wo die einzelnen Musiker in meiner Vorstellung etwa sitzen könnten. Dem Trompeter muss ich einen besonders aufmerksamen und aufmunternden Blick zuwerfen, denn der beginnt das Werk mit seinem markanten Marschthema.
Dann noch ein letzter Blick zum Konzertmeister – ich entschließe mich für eine Frau, eine sehr hübsche und attraktive Frau sogar, die mich während den Proben angehimmelt hat und die ich nach dem Konzert zu einem Schlummertrunk einladen werde, um dann mit ihr zu schlafen. Sie erwidert meinen Blick und nickt mir zu. Ich antworte ihr ebenfalls mit einem entschiedenen Nicken und hebe den Stock zum Einsatz.
Und jetzt? Zunächst mir nochmals einen tüchtigen Schluck genehmigen. Den habe ich redlich verdient.
Dann der Griff zur Fernbedienung, kurzer Druck auf die Play-Taste des CD-Players, und dann geht’s endlich los. Mahlers Fünfte, gespielt von den Wiener Philharmonikern, geleitet von Leonard Bernstein, nachdirigiert von Fabrice Steinmann. Mein Schwanengesang. Ich laufe durch das Zimmer der Ferienwohnung in Gigaro, hebe die Arme, gebe Einsätze, forme mit den Händen mal geschmeidig, mal energisch unsichtbare Gebilde und tanze zum Teil wie ein Besessener im Takt der Musik. Ich schreie so laut wie ich kann und übertöne damit beinahe gar den Tutti-Einsatz, der in diesem Moment aus den Lautsprecherboxen dröhnt.
Ich bin der Dirigent. Mein Wille geschehe.
Als rotznäsiger Teenager habe ich mir das so vorgestellt und in unserem Haus nachgespielt – natürlich nur, wenn ich alleine und sicher war, dass mich niemand dabei beobachten konnte.
Ich wollte wie mein Vater sein, hatte ihn in den Konzerten gut beobachtet, sein Auftreten, seine Eleganz, alles wie selbstverständlich, völlig natürlich und normal.
Probt ein Dirigent so etwas? Überlegt er sich genau, wie er das Podium betreten, den Applaus entgegennehmen, die Stille abwarten und dann den Taktstock heben will? Oder tut man das einfach so? Ergibt sich das? Muss man sich das erarbeiten?
Immer und immer wieder habe ich das für mich geprobt – der Dirigent vor dem Orchester. Alle Varianten habe ich ausprobiert, so wie ein Schauspieler sich sein Rolle aneignet.
Ich stand vor dem Spiegel, habe mich während des Dirigierens beobachtet, sah mir dabei genau ins Gesicht, habe strenge Blicke ausprobiert, wie ich sie bei Vater gesehen hatte, Blicke, die fordern und strafen können. Aber auch glücklich musste ich von Zeit zu Zeit aussehen, den Instrumentalisten zeigen, dass die letzte Passage sehr gut gespielt worden war. Ich probierte aus, wie es wirkt, wenn ich eher ruhig dirigiere, mich auf das Taktschlagen beschränke, nur hie und da mit der linken Hand einen Einsatz gebe, vielleicht auch mal abwinke, wenn jemand zu laut gewesen ist. Oder wie sieht das aus, wenn ich mich dem Rausch der Musik hingebe, einem Derwisch ähnlich, auf dem Podium hüpfend, tanzend, alles hinaus schreiend.
Wie oft hatte ich mir das durch den Kopf gehen lassen, vor dem Spiegel durchgespielt, alles so, wie ich es meinem Vater abgeschaut hatte – ich wollte werden wie er. Wieso eigentlich? Ging es mir damals als junger Bursche wirklich um die Musik, ging es mir darum, mit dem Klang des Orchesters das Publikum zu verzaubern? Ich glaube nicht.
Читать дальше