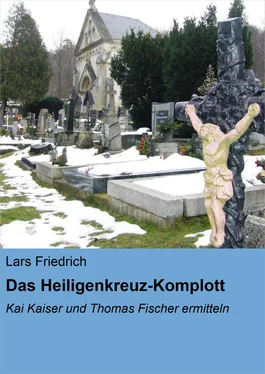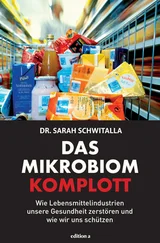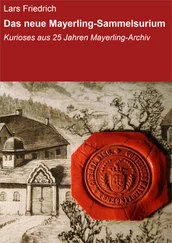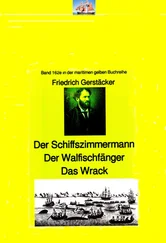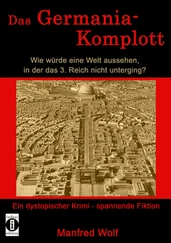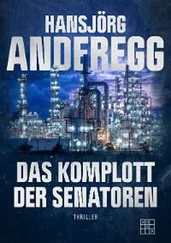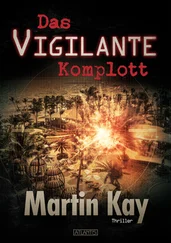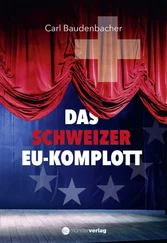„Pater Laurentius wartet auf uns. Er ist seit seinem neunzehnten Lebensjahr in Heiligenkreuz. Er zeigt uns das Stift und...“
Die Tür der Klosterverwaltung schwang auf - ohne Quietschen oder sonstiges Geräusch. Wir waren ja auch nicht in Gruselgeschichten unterwegs. Der Mann, der die Klinke in der Hand hielt, war keine Einssechzig groß, ging gebückt, trug dicke Brillengläser und hatte kurze graue Haare. Pater Dr. Franz Laurentius Lenz OCist, seit acht Jahren Kämmerer in Heiligenkreuz. Er war von seinem Abt beauftragt worden, den deutschen Journalisten das Wienerwaldkloster zu zeigen.
Dr. Bernhard Godefried von Bouillon war mit seiner Entscheidung zufrieden, denn Kontakt jeder Art zu Außenstehenden war dem Prälat des Zisterzienserstiftes zuwider.
Mit markiger Stimme begrüßte der Kämmerer seine Gäste.
„Laurentius, habe die Ehre. Sie sind pünktlich, was freut.“
Er reichte uns seine Hand.
„Von acht bis zwölf Uhr gehen die Mönche ihrer Arbeit nach, dann beten wir Terz und Sext, im Anschluss Mittagessen. Danach wird die Non gebetet, Arbeit von 14 bis 18 Uhr, im Anschluss Vesper.“
Er trat aus der Tür, hakte sich, wie selbstverständlich Halt suchend, zwischen uns ein und führte uns bestimmend in Richtung Pforte.
„Nach gemeinsamem Abendessen im Refektorium ist Rekreation – also Pause – und um 19.50 Lesung aus den Regeln des Heiligen Benedikt. Danach singen wir die Komplet. Silentium nocturnum bis Viertel fünf. Dann Virgilien und Laudes, die ersten Chorgebete und um zwanzig nach sechs Heiligen Messe. Mitschreiben müssen sich nichts, das lesen sie alles in unseren Schriften nach!“
Widerstand zwecklos.
Der Kämmerer schob uns durch die kleine Öffnung, die im wuchtigen Klostertor ausgespart worden war. Für sein Alter – geschätzt Anfang siebzig – und die gebrechliche Haltung war er agil und fordernd.
„Sie sehen, meine Freunde, klösterliches Leben gestaltet sich im Rhythmus von Gebet und Arbeit. Warum und für was, fragen sie sich?“ Er ließ uns los, machte einen Schritt nach vorne, drehte sich herum und sah uns über die Hornbrille hinweg an.
„Leugnen sie nicht, das fragen sich alle. Nun“, der Kämmerer fuhr sich mit der Linken über den kurz geschorenen Kopf. „Alle Elemente unseres klösterlichen Alltags – egal ob privates oder gemeinsames Gebet, die vielfältige Arbeit, die Geistliche Lesung, das Gemeinschaftsleben oder die Erholung – hängen zusammen.“
Pater Laurentius drehte sich wieder herum, vergrub die Hände unter dem schwarzen Überwurf seines fast weißen Gewandes und schlurfte gebeugt vor uns her. Kiesel knirschten unter unseren Schritten.
„All diese Elemente ergeben eine Lebensform, die uns Mönchen helfen soll, Egoismus zu überwinden und frei zu werden für die Liebe zu Gott – und natürlich zum Nächsten.“
Er blieb stehen, Kai und ich auch.
Wir standen in einem Innenhof, in dessen Mitte wuchtige Platanen einen Brunnen umstanden und sich eine weiße, mit goldenem Zierrat überladene Säule in strahlend blauen Maihimmel reckte. Zwei Seiten des Hofes waren von doppelstöckigen Arkadengängen umgeben, linker Hand wurde die getünchte Klosterfassade von der wuchtigen Front einer romanischen Kirche durchbrochen. Hinter uns, über der Klosterpforte, erhob sich ein rechteckiger Turm.
„Meine Freunde, ich heiße sie in Heiligenkreuz willkommen. Heute sind viele Menschen von der romantischen Atmosphäre, die unser Kloster verbreitet, fasziniert. Heiligenkreuz ist aber mehr als dieses Kloster. Unsere Brüder arbeiten in der Seelsorge und unterrichten an der päpstlichen philosophisch-theologischen Hochschule. Wir sind ein alter Orden und wir sind uns unserer heiligen Aufgaben bewusst: in den Zeiten des sich immer mehr ausbreitenden Materialismus stellen wir uns gegen die Verdunkelung und Auflösung. Wir sind gegen die weiter fortschreitende Bedeutungslosigkeit der Kirche und weisen ihren Mitgliedern den einzigen Weg zur Erneuerung: indem wir den alten Sinngehalt der Religionen an sich und des Christentums im Besonderen aufzeigen. So ist das.“
Laurentius machte Pause.
„Aber auch das können sie nachlesen.“
„Das ist es, was ich unseren Lesern auch mitteilen möchte. Genau das“, versicherte ich. Der Kämmerer nickte und wies auf die Steinfront der Abteikirche.
„Dort geht es lang, meine Freunde. Den besten Eindruck von der mächtigen Klosterkirche bekommt man von der Stelle, an der sich Lang- und Querhaus kreuzen – der Vierung.“ Uns vorausgehend, verschwand der Kämmerer durch eine kleine Tür links neben dem Hauptportal in der Westfront der Kirche, durchquerte mit uns einen Vorraum und sperrte ein wuchtiges, mehr als mannshohes schmiedeeisernes Gitter auf. Zwischen den kunstvoll verzierten Kirchenbänken ging Pater Laurentius in Richtung Altar. Dieser stand, von nahezu unsichtbaren Scheinwerfern prachtvoll ins rechte Licht gerückt, unter einem Baldachin aus Stein. Ein wuchtiges Kreuz hing von der Decke, goldene Verzierungen glänzten.
„Die Kirche wurde in zwei Etappen gebaut: Noch im zwölften Jahrhundert entstand zunächst diese dreischiffige romanische Basilika. Im 13. Jahrhundert kam eine Chorhalle als erster gotischer Bau diesseits der Alpen hinzu. Hauptalter und Seitenaltäre sind Neugotik, die Orgel mit ihren 4500 Pfeifen stammt aus dem Jahre 1804.“
„Kai, machst du Bilder?“
Er schüttelte den Kopf und flüsterte in die Stille der Kirche ein "Später.“
Pater Laurentius fuhr in seiner Expressführung fort.
„Das Chorgestühl wurde von Giovanni Giuliani geschnitzt und ist schönstes Barock. Jetzt bitte weiter durch die Sakristei in den Kreuzgang.“
Wir verließen die Kirche durch eine Nebentür und gelangten in jenen Raum, der zur Aufbewahrung von Liturgiegeräten und Gewändern diente.
„Die Wandmalereien der Sakristei stammen aus dem Rokoko, die Schränke mit ihren Intarsien sind das Werk zweier Mönche am Beginn des 19. Jahrhunderts. Lesen sie es nach. Na ja, renoviert werden müsste es allenthalben mal.“
Schon standen wir im Kreuzgang. Durch die Arkadenbögen blickten wir in einen begrünten Innenhof. Einige wenige steinerne Bögen beherbergten fast farblose Fenster mit einfachen Ornamenten, nach Pater Laurentius zu Teilen schon über 800 Jahre alt. „Die Grabsteine unseres romanisch-gotischen Kreuzganges stammen von Wohltätern, die im Mittelalter das Kloster mit Grundstücken, Weingärten und sonstigen Gaben beschenkten. Aus Dankbarkeit erhielten sie dann in geweihter Erde unseres Klosters ihre Grablege. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Steine aus auf dem Boden genommen und senkrecht an den Wänden angebracht. Seither geht es ich auch leichter...“
Der Pater Kämmerer zeigte auf die Steine, die entlang der getünchten Mauer standen. „Hier ruhen zudem Äbte unseres Klosters wie Alberich Fritz, 1787 verstorben und Abt Nikolaus von Kasch, 1824 beigesetzt.“ Ihre Grabsteine waren in engen Zeilen mit lateinischen Inschriften bedeckt, die meist nicht mehr zu entziffern waren – von Mönchen abgelatscht!
Kai sah sich um.
„Wer liegt hier, bei diesen zwei Gestalten?“
Kaiser zeigte auf eine Grabplatte ohne Kreuz und Inschrift, die in einer dämmerigen Ecke des Ganges lehnte. Das Bild im Stein zeigte einen barfüßigen Mann, der mit seiner rechten Hand auf den Boden wies. Er ließ sich wohl von einem Tier oder einem Gnom tragen, was aber nicht besser zu erkennen war.
Der Kämmerer verzog das Gesicht - keine Ahnung, ob überrascht oder ablehnend. Aber: Die braunen Augen funkelten hinter den Scheiben seiner Brille.
„Dies ist das Grab Herzog Heinrich des Grausamen, des jung gestorbenen und nie an die Regierung gekommenen Sohn Leopolds des Sechsten von Österreich. Die Historiker meinen, er habe in Abwesenheit seines Vaters einen Aufstand gegen diesen angefacht. Ungewöhnlich für seine Zeit wurde sein Leichnam verbrannt und seine Asche hier im Kreuzgang verstreut. Er wird als barfüßiger Büßer dargestellt, zu dessen Füßen der Teufel in Affengestalt hockt. 1254 wurde dieses Relief mit dem Gesicht nach unten über das Grab des Marschalls Bertold von Treun gelegt, dessen Grabinschrift sich jetzt also dort auf der Rückseite befindet.“
Читать дальше