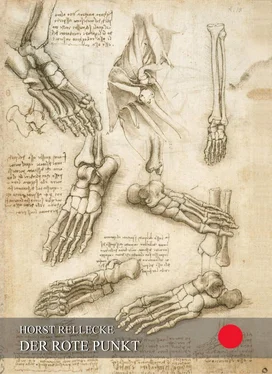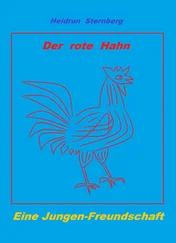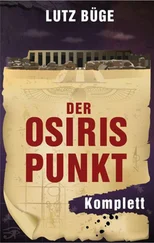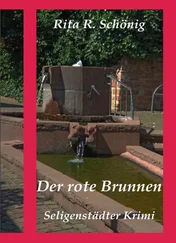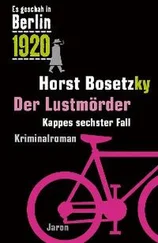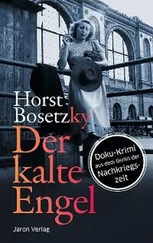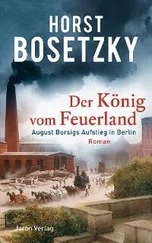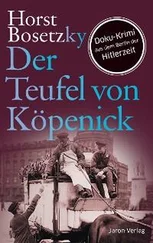Kohoutek wusste aus früheren Begegnungen, dass er keine Chance auf ein einfaches Frage-Antwort-Spiel haben würde, wenn er nicht rechtzeitig einen Stock in die Gebetsmühle steckte.
„Nicht verwandt, nicht verschwägert.“
„Wie? Mit wem?“
„Mit Kohoutek I.“
„Ach – das nimmt mich wunder!“
„Zufällige Namensgleichheit.“
Der Versuch, Schlüsselworte zu vermeiden, die reflexartig vorbereitete Textbausteine abrufen, war ohnehin zum Scheitern verurteilt, aber jetzt hatte Kohoutek einen Volltreffer gelandet.
„Zufall?! Nein mein Freund. Der Zufall ist die armselige Erfindung derer, die den einfachen Weg gehen wollen, die mit billigen Erklärungen zufrieden sind, denen die Erkenntnis Angst macht, die Werden und Vergehen mit ihrer Ex-und Hopp Einstellung verwechseln. Augustinus hat mal gesagt, dass der ……“
Bevor nun auch noch Bonifatius, Thomas von Aquin oder Franz von Assisi ins Spiel kamen, ließ Kohoutek schon mal den Kopf der Katze aus dem Sack.
„Könnten wir mit Leonardo da Vinci anfangen?“
„Ah – Leonardo! Der Prometheus der Kunst! Keinen verehre ich mehr – keinen! Es ist ein Geschenk, dass wir hier jetzt im Gropius-Bau Anteil haben dürfen an diesem großen Geist. Vor ihm und nach ihm
findet sich kein Universalgenie, das sich mit ihm messen könnte. In aller Demut habe ich mich seinem Werk genähert und einen großen Geistesverwandten in ihm erkennen dürfen. Sein Werk hat das meine erst ermöglicht, weil es ……“
„Könnte man sagen, dass Sie ihn auch zitieren.“
„Alles Tun ist ein Zitat des zuvor Gedachten. Meine Arbeiten atmen seinen Geist. Aber ein Künstler muss die Grenze wahren zwischen dem Zitat aus Verehrung und dem schäbigen Diebstahl geistigen Eigentums.“
„Aber der Kunstmarkt wird überschwemmt mit solchen Arbeiten.“
Kohoutek hatte wieder ein Schlüsselwort getroffen. Kaum war die Taste des Rekorders gedrückt, wurde die Antwort abgespult.
„Dieser pervertierte Kunstmarkt interessiert mich nicht mehr. Von Kunsthändlern und Galeristen, diesen kleinkarierten Erbsenzählern, will ich mich nicht mehr länger aufhalten lassen auf meinem Weg ohne Moden und Maschen. Die handeln Kunst ja nur noch wie Aktien, wollen von den jungen Künstlern billig kaufen in der Hoffnung auf eine möglichst umstrittene Aufnahme am Markt, um dann, wenn die Marktschreierei Erfolg hatte, die Preise zu verdoppeln. Wenn das nicht reicht, wird in regelmäßigen Abständen ein Skandal nachgeschoben. Wer mich auf diese Stufe stellt, beleidigt meine Intelligenz.“
Als erfahrener Medienmann konnte Kohoutek die ganzen Klingeltöne wohl herausgefiltern und dann wäre darunter auch ein wahrer Kern erkennbar geworden, aber dieser großspurige Anspruch, die letzten Weisheiten in Stein zu meißeln, hatte erst Grimm und dann Müdigkeit zur Folge. Kohoutek strich in diesem Moment einen weiteren Namen von der Liste. Der große Rest des Gespräches oder besser gesagt gelegentlich unterbrochenen Monologes fand unter Ausschluss der Kohoutekschen Aufmerksamkeit statt.
10. Der schwarzweiße Perfektionist
Josh Gorsky hieß mit bürgerlichem Namen Josef Gorschinsky. Dass hier ein Künstlername her musste, ist leicht einsehbar. Die Uniform war allerdings weniger originell als der neue Name: die schlanke drahtige Figur sah man immer nur in Schwarz; die Glatze war keine Notglatze wegen Kranzbildung, sondern eine absichtliche, was dem selbst auferlegten strengen Habitus einer lebenden SchwarzWeiß-Grafik konsequent entsprach; eine extrem dunkle Sonnenbrille mit der Lichtdurchlässigkeit von schwarzem Isolierband, die er vermutlich nicht einmal im Bett abnahm, rundete das äußere Erscheinungsbild trefflich ab; ein kluger Kerl, der seine Möglichkeiten auf ganz unterschiedlichen Betätigungsfeldern sehr genau und effektiv einsetzte. Er wusste sehr wohl, dass für einen Künstler seiner Generation ein sicherer Umgang mit Pinsel und Farbe allein nicht ausreichen konnte, um sich in den oberen Etagen des Kunstmarkts festzusetzen. Bei manchen seiner Arbeiten rätselten sogar erfahrene Kollegen, auf welche Art und Weise er diese zustande brachte. In irgendeiner Weise waren Computer und Drucker im Spiel – das war sicher. Es schien eine Kombination von beidem zu sein: Vorbereitung mit dem Rechner und individueller Duktus mit eigener Hand. Nachdem hier die Grenzen fließend geworden waren, hatte der Kunstmarkt seine anfänglichen Vorbehalte für Arbeiten dieser Art ja längst aufgegeben.
Da er mit den zeitgemäßen Werkzeugen umzugehen musste wie wenige seiner Kollegen, nutzte er dieses Wissen auch für Arbeiten, die zunächst mit Zeichnung nichts zu tun zu haben schienen. So konzipierte er zum Beispiel Lasershows und Lichtkunstinstallationen und war grundsätzlich immer für eine neue überraschende Wendung gut. Nur zu verständlich, dass er auf seinen technischen Tricks den Deckel hielt. Dennoch hatten seine Handzeichnungen den individuellen scharfen Strich, die besondere Klasse, die es braucht, um sich aus der Masse zu erheben, und seine Bilder zeigten nie gesehene Traumwelten, die eindrucksvoll bewiesen, das noch längst nicht alles totgemalt war. Sein Thema war sehr schwer einzugrenzen: alte Handschriften im Cyberspace, Hightech zwischen den Ruinen versunkener Kulturen und virtuelle Welten unter dem Brennglas. Er war ein Wandelnder zwischen den Zeiten und Welten. Und so wie ihr Schöpfer im übertragenden Sinne wandelte, so wandelten auch seine Protagonisten durch seine irrealen Bildwelten.
Die Neidlosen hielten ihn für clever, die Ausgebooteten stöhnten aber auch oft: nicht schon wieder! Er hatte nämlich die Fähigkeit, immer und überall dabei zu sein, wenn es in der Nähe der so genannten wichtigen Leute etwas zu holen gab. Den Kollegen war schon öfter übel aufgestoßen, dass auf verschlungenen, selten nachzuvollziehenden Wegen, Aufträge für Lightshows, Multimedias und Installationen aller Art bei ihm landeten. Gorsky wusste, dass er gut war, verdammt gut sogar – aber er wollte es mehr als die anderen, dass das auch jeder wusste. Dazu gehört natürlich die Nähe zu allen Medien. Er hatte dafür gesorgt, das die wichtigen Leute in den Redaktionen ihn kannten und er sie. Kohoutek und Gorsky waren sich daher schon oft begegnet. Kohoutek verstand auch, dass Gorsky nicht einfach mediengeil war oder eine Macke hatte, sondern sein Geschäft nur ganz konsequent verfolgte – vielleicht ein bisschen zu konsequent. Ohne dass Bekanntschaft zu Freundschaft geführt hätte, war irgendwann mal das Du gefallen.
Gorsky lebte und arbeitete in einem Loft, wie ein Atelier ja jetzt bei Künstlern seiner Altersgruppe heißen musste, mit Graffiti auf der Feuerschutztür, an der eine Schweineschnauze aus Bronze einen Ring anbot. Zur Sicherheit war aber neben der Tür noch ein stinknormaler Klingelknopf. Kohoutek entschied sich gleich für die elektrische Variante, da er um die Größe der Arbeitsräume wusste. Die Tür wurde langsam und offensichtlich nur mit Mühe einen Spalt aufgetan und darin erschien ein süßer kleiner Lockenkopf von vielleicht drei Jahren.
„Jooohosh – da is einer!“
Es kam nicht Josh, sondern Jana, die Lockenkopfmutter, für die der Besucher auch schon mal einen verregneten Dienstagnachmittag hätte opfern mögen.
„Herr Kohoutek nicht wahr. Gehen Sie ruhig durch. Josh ist in seiner Denkfabrik. Da hat er sich schon den ganzen Tag verkrochen, weil er irgendein Problem nicht lösen kann.“
Das „Hallo“ fand keinen Empfänger. Irgendwo unter Rechnern, Scannern und Druckern musste er sein. Deshalb versuchte es Kohoutek ein zweites Mal. Unter einem Arbeitstisch erschien zuerst eine schwarze Lederjeans und dann löste sich der ganze Josh Gorsky aus einer vielköpfigen Hydra aus Kabeln und Steckern – und erstmalig konnte Kohoutek in dessen stahlblaue Augen sehen.
Читать дальше