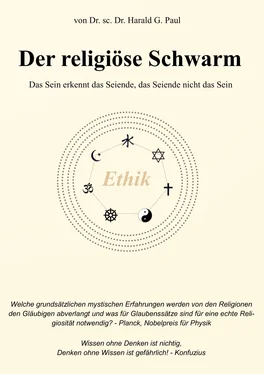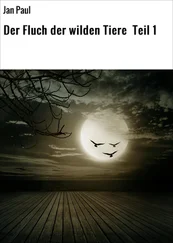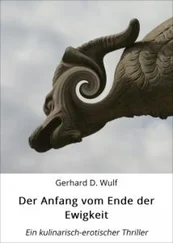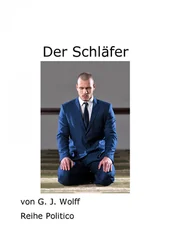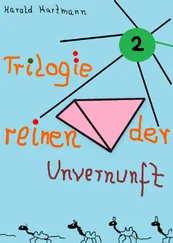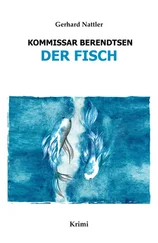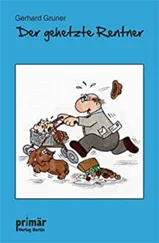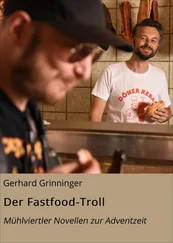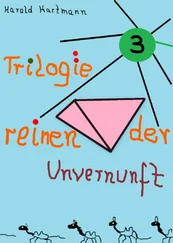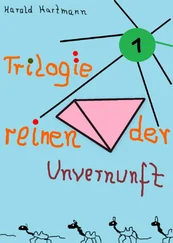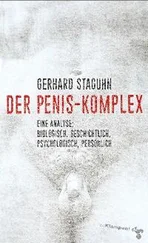Im Leben der halb-nomadischen Israeliten finden wir Hass und Liebe, Habgier und Freigiebigkeit, Gewalt und Friedfertigkeit, arrogante Überheblichkeit und Demut vor der Schöpfung, Grausamkeit und Mitleid. All dies geschieht unter einem mitfühlend strafenden und fördernden Gott. Zentrales Thema im Tanach ist die gotterfahrende Erziehung der Israeliten hin zum ständigen Botenvolk.
Mit Jakobs Sohn Josef, seinem Lieblingssohn und erst im hohen Alter gezeugt, beginnt die Geschichte Israels. Aus Neid und Missgunst (1. Moses Kap. 2 [26]) verkaufen ihn seine Halbbrüder nach Ägypten in die Sklaverei, wo er zu Macht und Einfluss am Pharaonenhof (wahrscheinlich Ramses II., 1279 – 1213 v. Chr.) gelangte. Er verzeiht seiner Sippe diese Gewalttat und holt sie nach Ägypten, wo sie im fruchtbaren Weideland am Nildelta sesshaft werden sollten. Das bisherige nomadenhafte Leben im Hinterland Kanaans, die Küstenregion wurde ja von den Stadtstaaten der Phönizier kontrolliert, war mit seinen Hungersnöten und Teuerungen mühselig. Dies sollte ein Ende haben. Hier, in Ägypten wuchs der Stamm der Israeliten zwischen dem östlichen Nil-Delta und dem heutigen Suezkanal zu einem Volk heran (2. Moses Kap. 1, Vers 7, [26]). Wahrscheinlich unter Merenptah (1213 – 1204 v. Chr.), dem Sohn und Nachfolger Ramses II., gerieten die Israeliten größtenteils in die Fronsklaverei. Es ist eine Geschichte von an Gott zweifelnden Menschen, die von Gott gestraft werden und Vergebung erfahren und ihren Glauben wiederfinden. Es war ein Weg der Prüfungen durch ein hartes bedrückendes Leben, eine Wanderung auf einen Weg hin zur Seinsethik der allumfassenden, allmächtigen Wesenheit „Gott“, geführt durch oft schwer durchschaubare Botschaften und Offenbarungen.
Nachdenklich stimmt ein Offenbarungserlebnis des Moses, in dem Gott zu ihm aus einem „brennenden Dornbusch“ spricht. (Dieser Vorgang kann als eine, in der überreizten Vorstellungswelt von Moses gewachsene Assoziation betrachtet werden, aber anderes ist ebenfalls in das Bild hinein interpretierbar.) Hier versucht eine, für Menschen nicht vor– und darstellbare, nicht personalisierbare, allmächtige Wesenheit „Gott“ einer Person, die eine Personalität über eine Benennung braucht, seinen „Namen“ zu nennen. Und, so verstand es Moses, Gott sprach: „Ich werde sein, der ich sein werde. … Also sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich werde sein, hat mich zu euch gesandt.“ (2. Moses Kap. 3, Vers 14, [26]). In anderen, mehr zeitgemäßen Übersetzungen antwortet Gott dem Moses auf die Frage, in wessen Namen er zum Volk sprechen soll: „Ich-bin-da hat mich geschickt.“ Man denkt bei dieser Antwort unwillkürlich daran, dass Gott hier mitteilt: ICH bin nicht benahmbar! - Was eine faszinierende Analogie in der chinesischen Philosophie des Taoismus aufzeigt (Abschn. 4.4.2.3). – In diesen jüngeren Übersetzungen der Bibel wird nicht immer streng „wortwörtlich“ übersetzt, sondern des Öfteren eine weitestgehend dem Sinn entsprechende Übertragung versucht (z.B. [31]). (Diese 97-ziger Ausgabe gilt als eine zuverlässige, leicht verständliche deutsche Bibelausgabe.). Bei Luther beschreibt sich Gott im Jetzt des Moses als „Das, was sein wird“. Gemäß der neueren Bibelübersetzung definiert sich Gott als „Das, was da ist“. Jede der Übersetzungen wird sicher geprägt sein vom subjektiven Verständnis – das gewiss das Resultat einer qualifizierten Interpretation und fast über Jahrhunderte gehender kritischer Exegese sein wird. Doch warum sollten wir nicht akzeptieren, dass beide hier angesprochenen Übersetzungen nur unterschiedliche Aspekte der göttlichen Wesenheit abbilden? Das heißt, bei Luther erklärt sich Gott auf eine verstörend verstehbare Weise als etwas, das jetzt dasjenige ist, was es zugleich in der Zukunft sein wird. Der für uns beobachtbare Zeitfluss scheint für IHN nicht zu existieren? Bedeutet dies, dass der einzig allmächtige Gott zeitlos, an keine zeitlichen Abläufe gebunden, existiert? Für Physiker ist im Prinzip nur der einmalige Kosmos, die Gesamtheit des Seins, von dieser Art. Können wir, im Zeitfluss lebende Wesen, deshalb seinen Zugriff auf uns (z.B. Dialog Gottes mit Moses aus dem brennenden Dornbusch) nur über ein „Ereignis“ zu einer konkreten Zeit beobachten und verstehen?
In der jüngeren Bibelübersetzung antwortet Gott nur: „Ich bin da.“ - So wie der einmalige, allerfassende Kosmos, das Sein? - Damit ist inhaltlich kein wesentlicher Unterschied zu der Interpretation der Luther‘ schen Übersetzung vorhanden. Man fragt sich unwillkürlich: „Als was ist er da.“ Er ist ja etwas, was Moses und jedes bewusste Individuum, nicht in seinem Bewusstsein abbilden und verstehen kann. Mag sein, dass die Botschaft der göttlichen Wesenheit für den Menschen „Moses“ nur über eine, seiner geistigen Wahrnehmung zugeordneten Abbildung „brennender Dornbuschs“ erfassbar wurde. Die Antwort Gottes: „Ich werde sein, der ich sein werde. …“ bzw. „Ich bin da“ erklärt, dass er die nicht-benennbare Gesamtheit (Abschn. 4.4.2.3) des sich ständig wandelbaren Seienden ist. Das erinnert an die, im Hinduismus angenommene, heilige Selbstopferung der göttlichen Wesenheit: „Welt wird zu Gott. Gott wird zur Welt.“ Die Botschaft an Moses erscheint uns recht seltsam und verstörend. Denn es wäre naiv, sich Gott als Zeitreisender vorzustellen, der morgen etwas ist, was aus dem Jetzt folgt und im Jetzt etwas, das in der Zukunft „war“. Da aber als wahr geglaubt wird, dass Gott allmächtig ist, ist er andererseits keinem Gesetz unterworfen. Er bezeichnet sich gleichwohl als die Gesamtheit alles Seienden, als das nicht personalisierbare, einzig allerfassende, emergente Netzwerk von Zustandsalternativen alles Seienden (Abschn. 2.3.1). Eine nachgerade verblüffende naturphilosophische Tiefe wird hier, an dieser Bibelstelle suggeriert. Was für eine Verkündigung an Moses, an einen Menschen in dieser frühen, antiken Zeit. Kein Wunder, dass an diese geistige Botschaft sein Bewusstsein fantastische Wahrnehmungen anheftete.
Der Pharao, ein Gottkönig seiner Zeit, wollte das Volk der Israeliten, die dem einzigen Gott und somit nicht ihn huldigten und ein Fremdkörper in seinem Reich waren, beseitigen. Ihre unmenschliche Unterdrückung mündete im Zwang zum Kindesmord, um männliche Nachkommen zu unterbinden. Die Mütter und Hebammen der jüdischen Stämme widersetzten sich mit allen Mitteln und setzten beispielsweise in ihrer Angst Kinder aus, in der Hoffnung, dass diese als Nicht-Israeliten irgendwo ein neues zu Hause finden würden.
Moses als jüdisches Findelkind am Hofe des Pharao erzogen, ergreift Partei für sein Volk, erschlägt einen ägyptischen Sklaventreiber und führt die jüdischen Stämme aus Ägypten. Auf wundersame Weise hilft ihnen Gott gegen die Armee des Pharao – so beschrieben in der Bibel.
Im jüdischen Glauben ist der, nach der Offenbarung Gottes aus dem „brennenden Dornbusch“, folgende Auszug aus Ägypten, der die Israeliten aus der Sklaverei führte, ein zentrales Ereignis und wird im Pessach Fest (Passa(h)) im familiären Kreis unter Beachtung spezieller Riten begangen. Dieses Befreiungserlebnis, geleitet durch die Offenbarungen von Moses, ist für jede Generation von essenzieller Bedeutung und im Judentum tief verwurzelt.
Die abenteuerliche und entbehrungsreiche Wanderung durch die Wüste endet vorläufig am Berg Sinai. Dieser Aufenthalt ist eine Zäsur und ein Neustart für die Juden. Gott schließt hier mit den Israeliten einen Pakt und übergibt Moses die „Zehn Gebote“ (2. Moses Kap 20, Vers 2 - 17, [26]) und zahlreiche Gesetze, Opferriten und Regeln für das tägliche Leben seines auserwählten Botenvolkes (z.B. 2. Moses Kap. 21 ff.). Der mehrfache Aufstieg am Berg Sinai, dazu die lange Abwesenheit von Moses verführt Ungeduldige unter den Israeliten sich einen neuen, eigenen, materiellen Gott, ein „Goldenes Kalb“ (die klassische Fruchtbarkeitsgöttin) (2. Moses Kap. 32, Vers 4, [26]) zu formen. Dieser extreme Rückfall in den Götzenglauben wird fürchterlich gesühnt und endet in einem Massaker. Denn nach der Rückkehr von Moses werden alle männlichen Abweichler erschlagen, 3000 an der Zahl, so wird im Bibeltext überliefert. Gott verzeiht - und wird wieder versöhnt mit der jüdischen Glaubensgemeinschaft.
Читать дальше