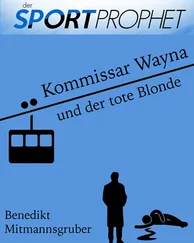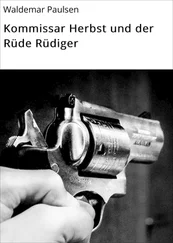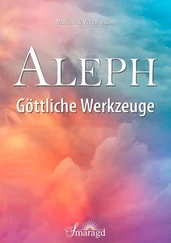Das Wasser ist nur warm, bis es kocht, wird es noch einige Zeit dauern, weshalb Rosalie, zur Untätigkeit verdammt, zu fragen beginnt.
„Verzeiht, Monsieur Debarcuse, wohin sollte euch die Reise ursprünglich führen?“
„Von hier aus? Weiter nach Biarritz und von dort wollte ich ein Schiff mit Ziel Südamerika nehmen, um meine Studien fortzusetzen.“
„Und ich, ich meine, Fabien hat euch nun davon abgehalten. Mir wird ganz mulmig, wenn ich darüber nachdenke, wie tief wir in euer Schuld stehen.“
„Ach was, Madame, wenn der Knabe wieder auf den Beinen ist, dann werde ich weiterreisen. Von Biarritz gehen häufiger Schiffe nach Südamerika. Mich erwartet dort niemand, deshalb spielt es keine Rolle, ob ich eine Woche früher oder später dort ankomme.“
„Aber Monsieur, ihr spracht vorhin von einem Geschäft auf Gegenseitigkeit, mir ist nicht klar, was ihr damit meint.“
„Nun, Madame, ihr gebt mir die Gelegenheit meine praktischen Kenntnisse zu erweitern und im Gegenzug bin ich dazu bereit, meinen Aufwand dafür nicht in Rechnung zu stellen.“
Das Wasser kocht nun hörbar und Rosalie macht sich rasch daran, den Wunsch nach dem starken Kaffee zu erfüllen. Ebenso wirft sie die erhaltenen Blätter in einen Becher und übergisst sie mit dem heißen Wasser. Mit dem Becher Kaffee in der Hand kehrt sie zu dem Arzt zurück, reicht diesem den Becher und setzte mit ihrer aufgesparten Antwort fort: „Das hört sich nicht schlecht an, Monsieur. Habt ihr schon häufiger auf diese Weise praktiziert?“
Lautstark schlürfte Monsieur Debarcuse von dem gereichten heißen Getränk und äußerste sich zunächst mit einem langgezogenem „ah, das tut gut“, um dann, als wäre es die natürlichste Sache der Welt, fortzufahren: „Nein, Madame, dies ist meine erste Operation.“
„Es ist das erste Mal, dass ihr ohne Honorar operiert?“
„Ja“, stimmt der Mediziner zu, „aber es ist auch meine erste Operation überhaupt, wenn man einmal davon absieht, dass ich schon zahlreiche Mäuse und Ratten sezierte.“
„Was?“, entgleist nun Rosalie die Stimme und mit dem Instinkt, den nur eine Mutter aufbringen kann die ihr Kind schützen möchte, baut sie sich nun vor dem Arzt auf. „Ihr wollt an Fabien herumschneiden, wie ihr es zuvor an Mäusen und Ratten vollzogen habt?“
„Madame le Trec, bitte, beruhigt euch doch. Das Wasser kocht, der Tee ist durchgezogen. Demnach kann ich mich jetzt an die Arbeit machen. Ich sagte, dass ich bereit bin, eurem Sohn zu helfen. Welche Alternativen habt ihr sonst? Der Barbier könnte mit der Säge den Fuß oder das Bein abnehmen und sofern Fabien das überlebt, könnte er als Krüppel weiterleben. Ich hingegen möchte versuchen, seinen Fuß oder zumindest den Teil davon, der noch brauchbar erscheint, zu erhalten. Laufen wie alle anderen, wird er zwar auch dann nicht können, doch zumindest kann er wie ein Mann auf beiden Beinen Stehen. Es liegt an euch, Madame, es geht um euren Sohn“, spricht Monsieur Debarcuse nun fast flehentlich.
Aufgeregt und unschlüssig, welche Entscheidung sie fällen sollt, schreitet Rosalie hin und her. Dabei schaute sie den Arzt mit ernster Miene an, und es ist wohl das stöhnende „Mama“, welches von oben wieder nach unten dringt, das letztendlich den Ausschlag gibt. „Möge der Herr euch beistehen und möge der Herr mir gleichfalls vergeben. Monsieur Debarcuse, bitte, helft meinem Jungen.“
„Dann auf“, zeigt sich der junge Mann agil; „gebt mir eine Schüssel mit dem heißen Wasser und ihr könnt den Branntwein und den Tee nach oben schaffen. Alsdann werde ich mich an die Arbeit machen, solange das Tageslicht noch ausreicht.“
Rosalie stellt die geforderten Sachen neben Fabiennes Bett, währenddessen sich der Arzt über seine Tasche beugt und nach Gerätschaften fischt. Als erstes zieht er ein Messer hervor, das beinahe so lang, wie die Elle eines ausgewachsenen Mannes ist. Besonders auffällig daran ist jedoch die Klinge, die schmal und überaus dünn, bei einem Messer derartiger Größe, erscheint. Sie scheint so zart und scharf zu sein, als könnte man damit auch das feinste Haar der Länge nach noch einmal teilen.
Madame le Trec erschaudert bei diesem Anblick und kann den Blick nicht abwenden oder sich gar rühren. Nur kurz hebt der Monsieur den Kopf, um überaus freundlich und dennoch mit aller Bestimmtheit anzumerken: „Wenn ihm mich nun allein lassen wollt, Madame, und vergesst nicht, die Tür zu schließen.“
Widerwillig verlässt Rosalie den Raum, zieht die Tür hinter sich zu und macht sich auf den Weg nach unten. Durch die verschlossene Tür hört sie noch den Ruf: „Seht zu, dass immer ein Kessel mit heißem Wasser bereitsteht, Madame.“
Unten angekommen füllt Rosalie zunächst wie aufgefordert weiteres Wasser in den Kessel, dann lässt sie sich benommen und voller Unruhe auf einen Stuhl nieder. Zum erstenmal ist sie dankbar dafür, dass kein Kunde die sorgenvolle Ruhe stört. Doch kaum dass sie sitzt, steht sie wieder auf, nimmt eine neue Branntweinflasche aus dem Regal und tut, was sie noch nie zuvor getan hat. Wie ein Kerl setzt sie de Flasche an die Lippen und nimmt einen kräftigen Schluck des scharfen Getränks zu sich. Nach Luft schnappend geht sie zurück zu dem Stuhl, setzt sich und starrt mit stumpfem Blick auf den Dielenboden.
Schwach hört sie Fabien stöhnen. Die Zeit scheint stillzustehen, endlos verrinnen die Minuten, die Stunden. Dann schreit der Knabe so schmerzvoll auf, dass Rosalie erschreckt von dem Stuhl hochfährt. Noch lauter und markdurchdringend folgt der zweite Schrei des Sohnes, der abrupt abbricht. Rosalie ergreift erneut die Flasche mit dem Branntwein und nimmt abermals einen kräftigen Schluck. Doch jetzt schnappt sie nicht mehr nach Luft. Vielmehr ist deutlich zu erkennen, wie kräftig sie Ober- und Unterkiefer zusammendrückt, so dass die kleinen Muskeln an ihren Wangen hervortreten. Ihr Gesicht wirkt hart, wie in Stein gemeißelt. „Ich bringe ihn um, den Mistkerl, wenn er meinem Louisdor ein Leid zufügt“, denkt sie.
Nach schier endloser Zeit dringt endlich das typische Knarren von Fabiens Zimmertür nach unten. „Tücher, Madame, ich benötige einige makellos saubere Tücher“, folgt daraufhin die Stimme des Arztes. Rasch geht Rosalie nach hinten, in den angrenzenden Wohnraum, öffnete dort den Schrank und ergreift einige, der sorgsam zusammengelegten Tücher. Dankbar, nun endlich einen Blick auf ihren Sohn werfen zu können, eilt sie die Stufen hinauf. Aber nur einen spaltbreit ist die Tür geöffnet, an der Monsieur Debarcuse steht. Durch den Spalt hindurch entreißt er ihr geradezu die hingehaltenen Tücher und drückt gleich darauf die Tür dermaßen heftig zu, als wollte er mit dieser Wucht Rosalie die Stufen hinabstürzen.
Gleichermaßen wütend, wie auch ängstlich, begibt sich Rosalie wieder zu ihrem Stuhl und wartet, und wartet. Dann wieder das Knarren an der Tür, und schließlich Schritte auf den hinab führenden Stufen. Die Bluse am Kragen weit geöffnet, die Ärmel hoch hinauf gekrempelt und mit vom Schweiß glänzenden Gesicht steht nun der Arzt im Raum. In der einen blutverschmierten Hand hält er eines, der eben noch frischen Tücher, in der anderen Hand befindet sich das lange Messer. Man kann eher den Eindruck gewinnen, dieser Mann kehrte von einem Schlachtfeld zurück, als dass er sich um einen Kranken gekümmert hätte.
„Madame, bitte eine Schüssel mit nicht zu heißem Wasser und wenn möglich, einem Stück Seife dazu“, mehr sagt der Mann nicht, und Rosalie beeilt sich ohne nachzufragen, dass Gewünschte bereitzustellen. Sorgsam seift er seine Hände über der Schüssel ein, wäscht die Arme hoch hinauf, spült sie ab und fährt sich mit den neu eingeseiften Händen über das verschwitzte Gesicht und den Nacken und spült auch hier den Seifenschaum ab. Dann nimmt er das Messer, an welchem noch reichlich Blut klebt, säuberte auch dieses und trocknet es sorgfältig ab. Erst dann kommen die nächsten an Madam le Trec gerichteten Worte.
Читать дальше