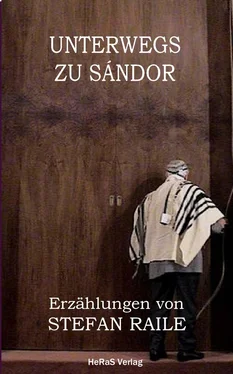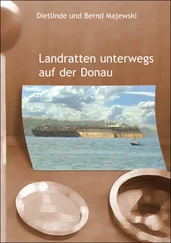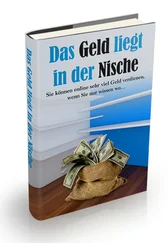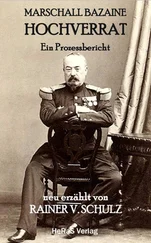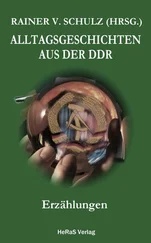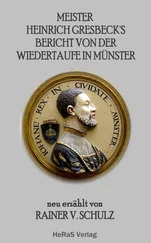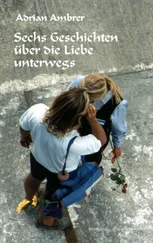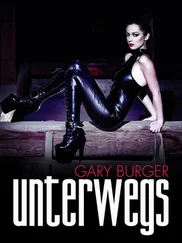Sehr oft, denke ich, als wir in der Metro sitzen, habe ich, wie einst, aus dem Kindergarten heimwärts unterwegs, jenen langen, von SS-Soldaten scharf bewachten Zug gesehen, der aus dem Süden heranrückte und nordwärts getrieben wurde. Ich bemerkte Junge und Alte, Frauen und Männer, Mütter, die ihre Säuglinge im Arm hielten, und Väter, die kleine Kinder auf den Schultern trugen. Manche taumelten und vermochten sich kaum noch auf den Beinen zu halten, verließen aber aus Furcht, beschimpft, getreten oder geschlagen zu werden, nicht ihre Reihen. Und dann entdeckte ich Sándor, der, mit seinen Eltern zur Kolonne gebracht, neben ihnen schritt. Er sah, schien mir, als Einziger furchtlos zu mir. Wollte er zeigen, dass er entschlossen war, sich der Gefahr zu stellen, wie er es später mit seiner waghalsigen Flucht bewies?
Diese Minuten – oder waren es vielleicht bloß Sekunden? – prägten sich mir so fest ein, dass sie mir nicht nur, solange wir in unsrem lindgrünen Haus wohnen durften, immer wieder in den Sinn kamen, sondern auch viel später noch, in Görlitz, wenn ich an der ungenutzten Synagoge oder am alten jüdischen Friedhof vorbeiging. Doch manchmal verschwamm das Bild und wich einem andren, durch das ich, glaube ich heute, mit Sándor gleichzeitig an daheim erinnert werden sollte: Ich meinte, ihn wie einst, als die Akazien weiß und lila blühten, tief über den Lenker gebeugt, auf seinem funkelnden Fahrrad zwischen den wenige Armspannen voneinander entfernten Baumreihen, die sich scheinbar schnurgerade vor den Häuserfronten erstreckten, über unsre ungepflasterte Straße fahren zu sehen, und Herkules, sein großer, zotteliger Hund, lief, ohne dass er Sándor einzuholen vermochte, hechelnd hinter ihm her.
Noch unsicher, wohin wir uns zuerst wenden wollen, steigen wir am Hotel „Astoria“ aus. Nachdem wir ein Stück gegangen sind, entdecken wir auf der linken Seite die zwei hoch aufragenden Zwiebeltürme der Großen Synagoge. Hinter ihr, am Tor des ehemaligen Gettos, stoßen wir auf eine Skulptur von Imre Varga. Sie ist Mahnmal für die jüdischen Toten des Zweiten Weltkriegs in Ungarn, zu denen ich vermutlich die meisten aus der Kolonne, die durch unser Dorf getrieben wurde, zählen muss. Es sollen, habe ich gelesen, über eine halbe Million Menschen umgekommen sein.
Während wir die stilisierte Trauerweide betrachten, deren lange, dünne, aus Chromstahl gefertigten Zweige mit den abwärts gewandten sieben Menora-Ästen verflochten sind und auf 30 000 Blättern die Namen von Ermordeten tragen, ist mir, als wäre ich mit Ines, weit über Haifa, sieben Kilometer vom Zentrum entfernt, wieder auf dem Campus der Universität vor einer ähnlichen Gedenkstätte. Baum der Schmerzen genannt, ist sie eine eigenwillige Stahlkonstruktion wie die, vor der ich jetzt mit Carola stehe.
Ein Stück neben dem Karmel National Park, zwischen Akazien und andren Bäumen versteckt, war sie nicht leicht zu finden gewesen. Sie soll sieben Meter hoch sein und aus 1400 dünnen, glitzernden Blättern bestehen, die an weit verzweigten Ästen hängen und bei Luftbewegungen eine Art sphärische Musik erzeugen, die, wenn man fähig ist, es zu hören, leisem, wehmütigem Seufzen gleicht, das im Wind verweht.
Wie oft, denke ich, mag Sándor, solange er an der Universität gelehrt hat, hingegangen sein, um sich an seine verschollenen Eltern zu erinnern?
Ich fühle mich ihm, ähnlich wie auf dem Campus am Rande von Haifa, plötzlich wieder nahe, als wären wir noch im Dorf, wo wir beide nicht bleiben durften. Mir wird bewusst, dass ich mich den Bildern, Gedanken und Empfindungen, die einst Erlebtes heraufbeschwören, bis heute nicht entziehen kann. Dabei dachte ich mal, dass Erinnerungen erlöschen, wenn man sie nicht wachhält. Sie verkümmern, glaubte ich, wie eine Sprache, die man erlernt hat und nicht mehr benutzt. Stück für Stück rutscht weg, Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, und was zurückbleibt, zerreiben die Jahre.
Nie vorher, begreife ich, habe ich klarer als jetzt erkannt, wie trügerisch meine Hoffnung gewesen ist.
Während wir zwei Tage später über den weiträumigen, gepflegten Farkasréti-Friedhof gehen, um die Gräber von Kodály, Bartók und andern aufzusuchen, meine ich, noch einmal vor dem Lebensbaum mit den abwärts gewandten Menora-Ästen zu stehen. Carola hat Augenblicke gezögert, mich zu begleiten, weil ihr Verhältnis zu den stillen, einsamen Ruhestätten zwiespältig ist.
„Grabmale ziehen mich an und schrecken mich ab“, hat sie mal gesagt. „Meist aber überwiegt die Neugier, versuche ich, aus den spärlichen Angaben, die der kalte Stein speichert, zu ergründen, wie die Toten, die unter ihm liegen, als Lebende gewesen sein mögen. Dabei erinnere ich mich oft an die Leute, die mir nahestanden, bis sie für immer gegangen sind.“
Auch Großmutter Gertrud, denke ich, ist schon lange gegangen. Wir mussten sie fern von ihrem Mann, meinem Großvater Anton, den ich, da er zu früh gestorben ist, nicht kennenlernen konnte, in Görlitz beerdigen.
Mir fällt ein, wie wir uns an jenem Tag, als bereits Hunderte deutsche Dorfbewohner, von mehreren Gendarmen bewacht, am Bahnhof auf ihren Bündeln lagerten und den Güterzug erwarteten, der uns nach Sachsen bringen würde, noch einmal heimlich entfernt, aus der Sommerküche Großmutters vergessene Brille geholt und den Rückweg über den Friedhof genommen hatten.
Vor Großvaters Grab blieben wir stehen, und derweil wir den hellen, fast weißen Stein mit der schlichten Aufschrift betrachteten, begriff Großmutter, erfuhr ich später, dass sie sich zum letzten Mal hier aufhielt. Es würde ihr nicht vergönnt sein, die Ruhestätte weiter zu pflegen. Wie immer, wenn sie sich am Grab aufhielt, glaubte sie, Großvater mit seinen graugrünen, lebhaften Augen, der kurzen, geraden Nase und dem gezwirbelten Schnurrbart vor sich zu sehen.
War es die ungute Vorahnung, die sie nach einem Ausweg suchen ließ? Was wäre, überlegte sie, wenn sie nicht zum Bahnhof zurückkehrte, sondern sich im nahen Wald oder in unsrer Weingartenhütte versteckte? Wer könnte sie dann noch zwingen, den Landstrich, mit dem sie sich zutiefst verbunden fühlte, zu verlassen? Aber wenn sie bliebe, würde sie für immer von uns getrennt sein. Schien eins nicht so schlimm wie das andre?
Sie kniete mit zuckenden Schultern, die Hände zum Gebet gefaltet, und es sah aus, als fehlte ihr die Kraft, sich zu erheben. Schließlich raffte sie sich doch auf und ging rasch mit mir davon, als fürchtete sie, es sich noch anders zu überlegen.
In den nächsten Tagen, die uns merklich kühler erscheinen als bei unsrem letzten Aufenthalt, obwohl wir da eine Woche später hier gewesen sind, suchen wir neben Orten, die wir vorher nicht gekannt haben, wiederholt vermeintlich vertraute Stellen auf, wo wir jedoch kaum etwas genauso antreffen, wie wir es vor einem Jahr wahrgenommen haben.
Als wir, nur ein Stück vom Heldenplatz entfernt, auf der Terrasse des versteckt gelegenen Restaurants sitzen und Mittag essen, kommt, solange wir dort sind, der graugetigerte, immer hungrige Kater, der mich an unsre einst zurückgelassene Macska Schneewittchen erinnert hat, nicht mehr; unter der uralten Platane hinter der Burg Vajdahunyad bleibt es, wenn kein Liebespaar zum Anonymus geht, gleichzeitig oder nacheinander seinen schon stark abgegriffenen Stift, den er zwischen den Fingern hält, wie einen Talisman berührt und sich dabei halblaut unterhält, ungewöhnlich still, weil der Harfenspieler fehlt; und auf dem mit Splitt bestreuten Platz im Stadtwäldchen, wo neben dem eingezäunten Spielfeld mehrere Bänke im Halbkreis stehen, die meist überwiegend besetzt sind, warten wir, derweil wir dem geschäftigen Treiben von Hunden, Sperlingen und Tauben zusehen, vergeblich auf den alten, hageren Mann mit bärtigem Gesicht, zottigem Haar, schäbiger Kleidung und abgelaufenen Schuhen, um zu beobachten, wie er zuerst Bier aus einer Dose trinkt, dann auf unnachahmliche Art die geschnorrte Zigarette hinter seiner Ohrmuschel hervorlangt und viele Male um Feuer bitten muss, bis jemand bereit ist, ein Streichholz für ihn anzureiben wie ich vor einem Jahr.
Читать дальше