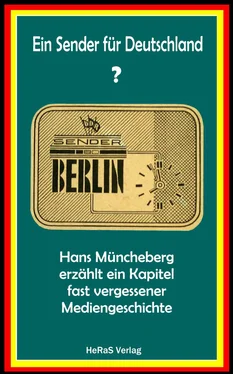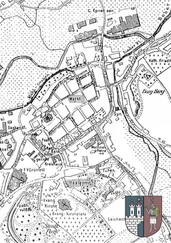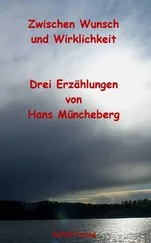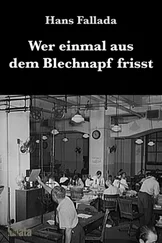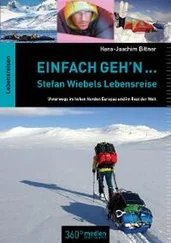Der August 1952 brachte einen erneuten Leitungswechsel. Wolfgang Kleinert kehrte mit Gründung des STAATLICHEN RUNDFUNKKOMITEES in den obersten Führungskreis zurück. Erster Intendant des FERNSEHZENTRUMS wurde Hermann Zilles. Er hatte als Verantwortlicher für die populären Betriebsabende des Berliner Rundfunks und Deutschlandsenders Erfahrungen bei der Vorbereitung zeitnaher, kritisch operativer Veranstaltungen und bei ihrer Direktübertragung aus Großbetrieben des Landes sammeln können. Das Hauptgewicht des künftigen TV-Programms musste auf Sendungen gelegt werden, die direkt, also im Moment der Aufführung übertragen werden. Und so erhielt Zilles den Auftrag, redaktionell und produktionstechnisch alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass noch vor dem 25. Dezember 1952 mit einem offiziellen Fernsehversuchsprogramm begonnen werden konnte. Am 1. Weihnachtsfeiertag sollte nämlich in der Bundesrepublik, - und damit auch für Westberlin - ein reguläres Fernsehprogramm gestartet werden.

Einige Redakteure, Hans Joachim Hildebrandt als zweiter Regisseur und der Dramaturg Hermann Rodigast wurden an den jungen Sender verpflichtet, ein provisorisches Studio mit einer am Boden verschraubten Ikonoskop-Kamera aus-gerüstet, ein kleiner Filmstock angelegt, schließlich mehrere Dutzend Fernsehempfänger dem DDR-Handel zugeleitet. Am 16. November begann der Verkauf der Fernsehempfänger Leningrad und genau einen Monat später meldete die offiziöse Tageszeitung NEUES DEUTSCHLAND : "Auf einer Pressekonferenz teilte am Montag der Leiter des Fernsehzentrums Berlin, Hermann Zilles, mit, daß das offizielle Versuchsprogramm ab 21. Dezember, dem Geburtstag J. W. Stalins, täglich von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr laufen wird (...) Neben Filmübertragungen soll auch ein Fernsehspiel entwickelt werden, bei dem verschiedenartige Probleme mit den Mitteln des Fernsehens behandelt werden..."
Wenige Tage später wurde der Volkswirtschaftsplan 1953 in wesentlichen Auszügen veröffentlicht. Darin war von einer Verbesserung des Fernseh-Versuchsprogramms und der Ausdehnung der Empfangsmöglichkeiten über Berlin hinaus die Rede.
Der Geburtstag des Generalissimus war nicht nur gewählt worden, weil er einige Tage vor dem bundesdeutschen Fernsehstart lag. In jenen Jahren des Kultes um exponierte Persönlichkeiten der kommunistischen Weltbewegung wurde einem solchen Datum stets Feiertagscharakter verliehen.
Weil somit zwei Gründe zusammentrafen, erhielt der rechtzeitige Abschluss der zu bewältigenden Vorarbeiten den Rang eines, wie es damals hieß, Kampfzieles . Auch der noch schwache Testsender auf dem Alten Stadthaus konnte durch einen leistungsfähigeren 1-KW-Sender ersetzt werden.

2. Kapitel: Das offizielle Versuchsprogramm und die "kleine" Form

Am 21. Dezember 1952 zeigte sich zum ersten Mal das neue Kennzeichen des Senders auf den Bildschirmen. Es wurde beherrscht von den sechs hohen Buchstaben des Standortes BERLIN - grafisch den sechs Säulen des Brandenburger Tores zugeordnet -, rechts daneben die Fernsehuhr . Als sie auf die zwanzigste Stunde des Tages rückte, erschien nach einer kurzen Abblende die erste Ansagerin des FERNSEHZENTRUMS BERLIN auf dem Bildschirm: Margit Schaumäker. In einer kurzärmligen weißen Bluse stand sie zwischen den beiden, noch nicht vom Bildausschnitt erfassten Sprechertischen, an denen in gedeckten Anzügen der Intendant und sein späterer Oberspielleiter saßen. Vor einem Standmikrofon postiert, konnten die Zuschauer das ihr abgeforderte respektvolle Stehen höchstens ihrer etwas anderen Blickrichtung entnehmen. Was später zur Selbstverständlichkeit wurde, galt in jener Minute nicht. Man war noch nicht zum vertrauten Gast im Wohnzimmer des Zuschauers geworden, der dem Gerätebesitzer gegenübersitzen durfte.
Abblenden, schneller Schwenk der Kamera, aufblenden: Hermann Zilles stellte sich als Intendant des neuen Senders vor und kündigte an, man wolle nun allabendlich mit den neuesten Informationen, mit Kostproben der ernsten Künste und auch mit unterhaltenden Beiträgen ein abwechslungsreiches Zwei-Stunden-Programm bieten.
Abblenden, schneller Schwenk zu anderen Seite, aufblenden: Gottfried Herrmann schaute kurz in die Kameraoptik, dann senkte er den Blick auf einen ehrwürdigen Klassikerband und las mit ausdrucksstarker und wohlklingender Stimme Worte, Sätze, Verse aus dem Werk Johann Wolfgang von Goethes. Später wurde beziehungsreich erzählt, es sei der Westöstliche Diwan gewesen.
Abblenden, kurzer Schwenk zur Mitte, aufblenden: Mit verbindlichem Lächeln führte die ansagende Schauspielerin durch die weitere Sendefolge. Jeweils zu Beginn des Programms wolle man den verehrten Zuschauern in der Standardsendung Aktuelle Kamera Informationen zum Zeitgeschehen in Wort und Bild geben. Danach seien sie zu einer aktuellen Filmreportage in eigener Sache eingeladen: Fernsehen aus der Nähe betrachtet , dann...
Intendant Zilles, der den Ansagetext selbst verfasst hatte, blieb neben Margit Schaumäker sitzen und verfolgte jeden gesprochenen Satz, ihn mit dem geschriebenen vergleichend. Er konnte zufrieden sein.
Inzwischen hatten die Personen am 2. Sprechertisch gewechselt. Herbert Köfer, vom Deutschen Theater in Berlin zum FZ gewechselt, las die Meldungen der Aktuellen Kamera.
Abblende. Filmstart: Günter Hansel (Buch), Bruno Siebert (Kamera), Rolf Bramann (Schnitt) und Otto Holub (Regie) hatten einen filmischen Rundgang über das noch im Ausbau befindliche Gelände des FZ , wie das FERNSEHZENTRUM BERLIN verkürzt genannt wurde, unternommen und sowohl die bereits fertigen als auch die noch im Ausbau befindlichen Arbeitsbereiche vorgestellt. In 25 Minuten wurde der damals aktuelle Entwicklungsstand dargeboten, heute ein historisches Dokument.
Es folgten an diesem ersten offiziellen Fernsehabend aus Berlin-Adlershof zwei sowjetische Dokumentarfilme, mit denen der Sender den Jubilar des Tages würdigte. Ein Volkskunstfilm mit dem beschwörenden Titel Für ewige Freundschaft , dann als Abschluss ein Dokumentarfilm: Stalingrad .
Das Programm der ersten Sendewoche vermittelte bereits einen Eindruck von der thematischen Vielfalt in der redaktionellen Konzeption. Mehrere Sendereihen wurden eingeführt, um spezielle Zuschauergruppen anzusprechen: Freunde der Literatur, Liebhaber der Musik und des Tanzes, Kinder und ihre junggebliebenen Eltern.
So begannen Sendungen unter dem vielversprechenden Titel Das gute Buch . Bereits Heiligabend wurde der Roman Goya von Lion Feuchtwanger mit einer kurzen Lesung und einer einfühlsamen Buchbesprechung vorgestellt.
Da sich das live gesprochene Wort als probates künstlerisches Mittel anbot, wurde dieser Sendereihe schon nach wenigen Wochen eine weitere hinzugefügt: Meisterwerke Deutscher Kultur . In ihrem Rahmen erfolgte am 22.01.1953 die Premiere einer ersten Fernsehspiel-Szene, von Horst Heydeck nach dem Werk E.T.A. Hoffmanns gestaltet. In ihr blickten der Dichter, gespielt von Michael Degen, und ein Invalide, dargestellt von Werner Peters, durch Des Vetters Eckfenster auf die Berliner und kamen zu dem Schluss, das Volk habe an äußerer Sittsamkeit gewonnen.
Читать дальше