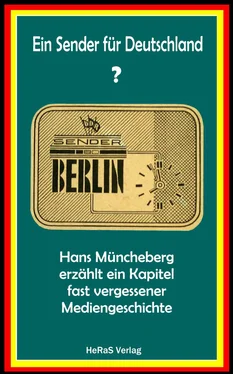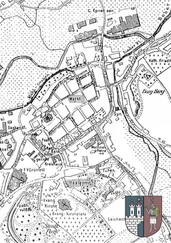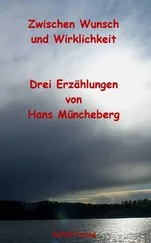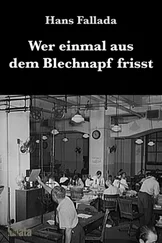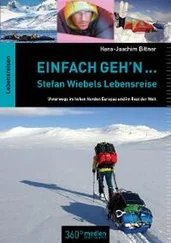Die ersten der allabendlichen Nachrichtensendungen hatte Wolfgang Kleinert allein zusammengestellt. Nach wenigen Tagen forderte er vom Personalchef des Rundfunks, Heinz (eigtl. Heinrich) Adameck, ihm einen beweglichen jungen Redakteur für diese und andere Sendungen zu verschaffen.
Die Wahl fiel auf Günter Hansel, Absolvent der Funkschule, von dort her dem ihn einst unterrichtenden Wolfgang Kleinert bekannt. Seit Anfang des Jahres war Hansel Hilfsredakteur beim Sender Weimar. Er wurde nach Berlin beordert und Hals über Kopf in die Arbeit geworfen. Darüber notierte er später aus seiner Erinnerung: "In mir die quälende Ungewissheit: Was ist das, Fernsehen? Was ist hinter den vielen weißen Gebäuden, hinter der gewölbten Wand, die aussieht, wie der Eingang zu einem Theater? Wer sitzt in diesem achtstöckigen Turm?

Das Auto hält vor einem verglasten Zwischengang zweier Gebäude... Ich stapfe hinter Wolfgang Kleinert die zwei Etagen hoch... Er knallt mir einen Stapel Fotos auf den Tisch. Das ist die Sendung von heute Abend: Bilder aus dem Zeitgeschehen! Ich starre auf diesen Stapel von Fotos... Was soll das sein? Eine Sendung?
Aus diesen Fotos werden Diapositive gemacht, dann werden sie vorgeführt wie bei einem Lichtbildervortrag! Den Vortrag dazu schreibst du!
War mein Gesichtsausdruck zu ungläubig oder mein Grinsen zu breit? Kleinert feuert mir ein paar Manuskriptseiten über den Tisch: Hier, guck dir an, wie ich das in den letzten sieben Tagen gemacht habe..." (1)
Günter Hansel kam nach wenigen Tagen mit dem Vorschlag, für die Fernsehnachrichten einen kürzeren Titel zu wählen: Aktuelle Kamera , eine Ableitung von der Fotokamera der Bildreporter, nicht von der später dominierenden Filmkamera, aber der Name blieb erhalten, fast vier Jahrzehnte lang, geriet langsam in Verruf und rehabilitierte sich Ende 1989 und in den Monaten danach.
Die Bildnachrichten waren an jedem Abend neu, die drei Kurzfilme ließen sich aber nur in sechs Varianten der Abfolge senden. Sie mussten jedoch gesendet werden, denn anders ließ sich die geforderte Stunde täglichen Programms nicht füllen.
Es kam natürlich, was kommen musste: Ein Anruf aus dem Haus des Zentralkomitees der SED vom Leiter der ZK-Abteilung für Information Hermann Axen: "Wie lange wollt ihr denn das noch so weitermachen mit den Filmen? Habt ihr denn keine anderen Filme? Besorgt mal Filme, wir haben doch die DEFA." (1)
Wolfgang Kleinert wandte sich also vertrauensvoll an Sepp Schwab, damals noch oberster Chef der DEFA-Studios. Statt der gewünschten Leihgaben erhielt er von ihm nur eine Information über den Preis eines jeden Meters Film, der in den USA über das Fernsehen ausgestrahlt wird.
Als Chef eines embryonalen Fernsehens ohne eigenes Budget testete Kleinert per Telefon, ob er woanders auch derart rüde abgewiesen werden würde. Dem ihm persönlich bekannten Berliner Vertreter vom sowjetischen Filmvertrieb SOV-EXPORT erklärte er die prekäre Lage und erhielt zur Antwort, man könne ihm helfen, es käme nur darauf an, wie groß das mitgebrachte Geschenk sei. Wolfgang Kleinert berichtete später über den damaligen Versuch, einen Sponsor für das Fernsehfilmprogramm zu finden: "Nun wußte ich nicht, was er meinte (...) Jedenfalls habe ich in einem Netz drei Flaschen gut eingepackten Adlershofer Wodka mitgenommen. (...) Mit dieser Geste hat es zu einem sehr erfreulichen Erfolg geführt. Ich konnte mir sofort Die Steinerne Blume mitnehmen. Das war der erste Spielfilm, den wir in Adlershof zur Ausstrahlung brachten - allerdings immer eine Rolle, kurze Pause, Rolle und so weiter und so fort." (1)
Kurz darauf erhielt das Adlershofer Testprogramm weitere sowjetische Filme zu unentgeltlicher Ausstrahlung. Später hat sich Wolfgang Kleinert vorsichtig erkundigt, wie er die Überlassung so vieler Filme bewerten solle. Der SOV-EXPORT -Mann antwortete offen: " Ich gebe sie Ihnen gern, außerdem gucken ja hunderte Leute, darunter Manager, in Westberlin zu - und auf diese Weise sehen die auch unsere Filme, die ich dort nicht immer einzeln herausbringen kann." (1)
Mit geliehenen Filmen ließ sich zwar die tägliche Programmstunde füllen, unerfüllt blieb aber der Auftrag an die Redaktion, eigene und fernsehspezifische Sendungen zu entwickeln. Vom aktuellen Foto zum künstlerisch erzählenden Bild führte der nächste Schritt. Vor allem Kinder liebten, das wusste man, phantasiebeflügelnde Bilderbücher. Also wurden Probesendungen mit Diapositiv-Reihen und einer dazu erzählten Geschichte erarbeitet, und am 13. Juli 1952 hieß es zum ersten Mal an einem Nachmittag: Für Bärbel erzählt .
Es mag sein, dass die in Adlershof Experimentierenden zuerst froh waren, bei ihrer Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten keine Zuschauer zu haben. So blieb auch ein Zwischenfall ohne Folgen, der sich im Sommer 1952 ereignete. Berichtet wurde er von Otto Holub, dem ersten Regisseur des FERNSEHZENTRUMS . Holub war als Schüler Luftwaffenhelfer geworden, 1945 in englische Gefangenschaft geraten, aber bald in die Schule zurückgekehrt. Er hatte das Abitur gemacht und war danach als Sprecher-Volontär an den Landessender Halle gegangen. Dort begann er auch als Assistent beim Hörspiel zu arbeiten, wurde schließlich nach Berlin-Adlershof geschickt, glaubte, dort als Regieassistent zu beginnen und fand sich unvermutet als einziger Regisseur des Senders wieder.
"Es war so", berichtete er zwanzig Jahre später, "als ich ankam, gab es dort eine einzige Fernsehkamera, die aber noch gar nicht als solche eingesetzt werden konnte. Es war eine, die nur das bewegte Stationszeichen übertrug... Das erste Gesicht, das live über den Sender ging, war das Gesicht von Günter Hansel, der jetzt die Sendereihe macht »Alte Liebe rostet nicht«. Er unterhielt sich mit einem Techniker, ob, wenn man die Uhr abnehmen würde und wenn man den Kopf da reinsteckt, man sein Gesicht sehen könne.
Ja, ja – natürlich, selbstverständlich, sagte der.
Günter war sehr neugierig und wollte es versuchen. Der Techniker gab dem Drängen nach. Nun steckte Günter seinen Kopf rein. Wir guckten es uns auf dem Monitor an, und er macht seine Faxen. Es war recht lustig. Dann aber kam ein Anruf vom Sendeturm: Ihr seid wohl wahnsinnig geworden! Wir sind auf dem Sender!" (2)
Während es im Sommer des Jahres 1952 in der DDR noch kein Fernsehgerät zu kaufen gab, hatten in der Bundesrepublik verschiedene Firmen der einschlägigen Branche das kommende große Geschäft gewittert und bereits mehrere Typen von Fernsehempfängern entwickelt.
Zwar gab es auch in der DDR einen Betrieb dieser Art, das SACHSENWERK RADEBERG. Dort war bereits seit Anfang 1951 die Produktion des kombinierten Rundfunk- und Fernsehempfängers Leningrad T 2 angelaufen, die Produktion war jedoch im Rahmen der Reparationsleistungen vollständig für die UdSSR bestimmt. Es musste auf Regierungsebene verhandelt werden. Man kam zu dem Ergebnis, dass - bei deutlicher Steigerung der Stückzahlen im Sachsenwerk - ab Ende Juli 1952 einige Geräte in der DDR verbleiben durften. Sie wurden in den Klubräumen von Großbetrieben aufgestellt.
Nun war mit Zuschauern zu rechnen, die von dem neuen Medium neben der technischen Sensation Unterhaltung und Entspannung erwarteten. Die Fernsehredaktion musste versuchen, mit der Filmkamera einzufangen, was noch nicht mit einer Fernsehkamera zu erreichen war. Die ersten Film-Kameramänner wurden engagiert und gingen in den Berliner Friedrichstadt-Palast, in den Zirkus, ins Kabarett. Zusammenmontiert und mit überleitenden Texten versehen, begann am 3. August der Test für eine Sendereihe, die dann noch einige Jahre fortgeführt wurde: Das Fernsehkarussell .
Читать дальше