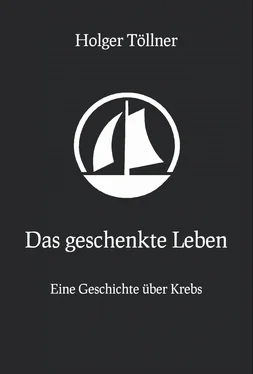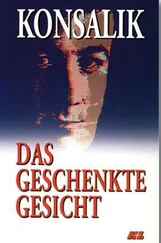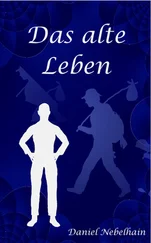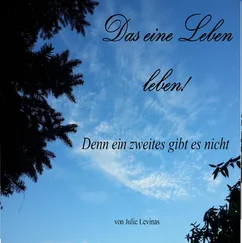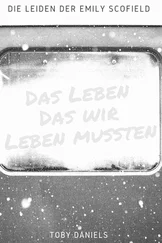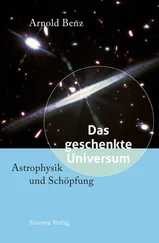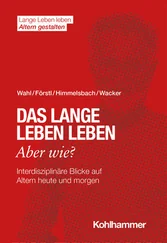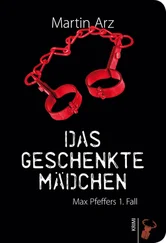No, Sir, jetzt erstmal schön den Ball flach halten, nehme ich mir vor.
Also begebe ich mich zur chirurgischen Ambulanz, um nachzufragen, wie es weitergehen soll. Den Weg kenne ich im Schlaf. Ich war schon mehrmals mit meinem Sohn hier. Er ist in der Uniklinik wegen diverser Platzwunden vom Eishockey und nach Skateboardunfällen immer bestens versorgt worden.
Die nette Dame hinter dem Tresen nimmt meinen Überweisungsschein routiniert entgegen, liest ihn durch und fragt, was ich konkret will.
Ich sage, „Keine Ahnung…, einen Termin oder was man in so einem Fall eben macht. Sie müssen entschuldigen, aber ich bin neu im Krebsgeschäft. Ich habe die Diagnose erst vor einer halben Stunde bekommen. Ich weiß es also leider nicht genauer.“
Sie muss etwas grinsen und sagt, „Warten Sie hier, ich kläre das. Vielleicht kann man gleich ein paar Untersuchungen machen. Klarheit ist doch immer das Beste.“
So ist es recht. Noch eine mitleidige Tante wie die Ärztin mit ihrer leeren Empathie hätte ich nicht ertragen. Profis tun irgendwas, anstatt dich zu bedauern.
Wenn etwas geschieht oder auch nur zu geschehen scheint, fühlt sich eine Situation weniger endgültig an. Das tröstet mehr als jedes dahingehauchte ‚Es tut mir, so, so leid.‘
Der gute erste Eindruck bestätigt sich. Nach kurzer Wartezeit erscheint ein Arzt, der sich als Doktor M vorstellt. Er ist um die Dreißig, hat schütteres dunkles Haar, Nickelbrille. Er sieht aus, wie der Held in der Fernsehserie Emergency Room, Doktor Marc Greene, dem er wie ein Zwilling gleicht. Ich werte das als gutes Omen. Doktor Greene ist in der Serie nämlich ein verdammt guter Chirurg. Das hoffe ich von seinem Mannheimer Doppelgänger auch.
Und siehe da, dieser Doktor Greene hier verspricht, noch heute mehrere Untersuchungen zu machen.
Mir wird Blut abgenommen, ich bekomme eine Ultraschalluntersuchung aller Weichteile und dank Doktor Greenes Tatkraft auch noch eine Ganzkörper-Computertomografie, kurz CT genannt. Alles in allem stellt sich heraus, dass ich einen faustgroßen Tumor in mir trage, der etwa fünf Zentimeter ab ano, also fünf Zentimeter von meinem Hinterausgang entfernt, rund um meinen Enddarm wächst und ihn allmählich zusammendrückt.
Und ja, sagt Doktor Greene, auch ohne das noch offene Ergebnis der Biopsie müsse man leider mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich um ein bösartiges Gewächs handele.
Während ich zur Besprechung des weiteren Vorgehens warte, kehren meine Gedanken zurück zu meiner Großmutter väterlicherseits, die mich als Kind in schreckliche Angst versetzt hatte.
Ich mochte sie nicht besonders, was unter anderem daher kam, dass sie mich im Alter von vier oder fünf Jahren einmal quer durch den Garten gejagt hatte, weil ich aus Versehen ihren halbvollen Eimer mit frisch geernteten Johannisbeeren umgestoßen hatte. Aus Versehen! Einzig ihr Geschrei war der Grund dafür, dass ich vor Schreck auch noch in die Beeren hineingetreten war.
Um sich für nicht einmal eine halbe Stunde vergeblicher Arbeit an mir zu rächen, schlug sie mir damals den Hintern grün und blau, eine Demütigung, die ich ihr niemals verzeihen konnte.
Sie war eine aggressive, herrische Person, die größten Wert auf Äußerlichkeiten legte. Meine Großeltern betrieben damals eine Pension im Oberharz. ‚Fremdenzimmer mit fließend warm und kalt Wasser‘ versprach das Werbeschild an der Toreinfahrt vor dem Haus.
Ein winziges Klo mit Dusche für alle Gäste auf dem Flur im Erdgeschoss und billige Marmelade aus Fünf-Liter-Eimern zum Frühstück, sagte es dagegen nicht. Dennoch kam das der Wahrheit wesentlich näher. Die Pension mit dem Standard der Fünfzigerjahre überlebte dank Stammgästen. Der Herr Doktor Soundso und der Herr Pfarrer Soundso und der Herr Gewerbelehrer mit Gattin, das war die Lieblingsklientel meiner Oma.
Eines Tages, ich war elf Jahre alt, fand ich meine Großmutter weinend vor dem Badezimmerspiegel, in der Hand ein großes Büschel Haare, das sie durch ihre Tränen hindurch anstarrte. Auf meine Frage, was los sei, warf sie die Haare ins Waschbecken und drehte sich um. Sie beugte sich herunter, sah mir in die Augen und legte beide Hände auf meine Schultern.
„Weißt Du, was Krebs ist?“, heulte sie.
Ich nickte, obwohl ich es natürlich nicht so genau wusste. Aber nach allem, was ich von den Erwachsenen mitbekommen hatte, musste es sich um etwas überaus Schreckliches handeln. Daraufhin schüttelte sie mich, wie man ein ungezogenes Kind schüttelt und schrie, „Und das habe ich nämlich!“
Dann war sie schluchzend vor mir auf die Knie gesunken und umklammerte mich wie eine Ertrinkende, sodass ich das Gefühl hatte, an ihrer Brust ersticken zu müssen. In meinem Entsetzen strampelte und boxte ich um mich, bis sie mich losließ, und rannte davon. In den folgenden Monaten verfiel sie mehr und mehr und starb schließlich qualvoll. Ich habe sie nie wieder besucht.
Fortan hatte ich namenlose, regelrecht panische Angst davor, dass meine armen Eltern, mein kleiner Bruder oder andere geliebte Menschen ebenso grausam sterben könnten wie meine Oma. Der Gedanke an Krebs krampfte mir jedes Mal die Eingeweide zusammen und erfüllte viele Nächte mit Angst und Schrecken. In meinen Alpträumen griff meine Großmutter wieder und wieder nach mir, sah mich mit ihren rotgeweinten Augen an, versuchte, mich zu umklammern und mit sich in die Dunkelheit zu nehmen.
Die Alpträume, schreckliche Verlustängste und mein schlechtes Gewissen, die sterbende Frau in ihrer Verzweiflung so jäh zurückgewiesen zu haben, begleiteten mich bis zum Abitur. Eigentlich hätte ich in die Hände eines Psychotherapeuten gehört. Doch merkten meine Eltern vom abrupten Ende meiner unbeschwerten Kindheit nichts, weil ich mit niemandem über meine Sorgen sprach.
Wunderbarerweise gelang es mir, mich mit der Zeit selbst zu therapieren. Ich hatte zwar das Pech, ein humanistisches Gymnasium besuchen zu müssen, wo man uns ein großbürgerliches Bildungsideal aus dem 19. Jahrhundert einhämmerte, das auf unsere Lebenswirklichkeit nicht zutraf. Mein großes Glück war aber, dass dort wegen der Ausrichtung der Schule neben den klassischen Fächern, antiker Kultur und alten Sprachen, auch Philosophie unterrichtet wurde.
So kam es, dass ich mich mit altgriechischer und römischer Weisheit beschäftigen durfte. Ich las über die Vorsokratiker, die Sophisten, Platon, Sokrates, die Stoiker und andere. Ich war beeindruckt davon, dass Sokrates sein Leben für seine Überzeugungen geopfert hatte und Seneca sich sogar selbst tötete, beziehungsweise durch einen Sklaven töten ließ, um Nero, der ihn umbringen wollte, zuvorzukommen.
Offensichtlich hatte der Tod für sie alle keinen Schrecken. Besonders gut gefielen mir auch die Ansichten Arthur Schopenhauers, der es letztlich schaffte, mich davon zu überzeugen, dass der Tod nichts ist, vor dem man sich fürchten muss. Die Stoiker halfen bei der Bekämpfung meiner Verlustängste. Denn alles ist Schicksal. Der Mensch muss einfach in allen Situationen sein Bestes tun, dann ist der Rest Bestimmung. Deswegen hilft es auch nichts, sich wegen möglichem zukünftigem Unglück zu ängstigen. Man verschlechtert damit nur sein gegenwärtiges Leben, ohne das Geringste an seinem Schicksal zu ändern. Wenn man es ordentlich durchdenkt, ist alles vollkommen logisch.
Alles das hatte ich mir während der Pubertät erarbeitet und dadurch schließlich meine jugendliche Unbeschwertheit zurückerobert. Dank Schopenhauer & Co. wurde ich die Alpträume endgültig los. Mit meinem weltanschaulichen Grundgerüst kam ich so gut klar, dass ich seit Jahren überhaupt nicht mehr über Tod und Verlust nachgedacht habe. Bis heute. Innerhalb der vergangenen halben Stunde im Wartezimmer der Uniklinik Mannheim ist nach wenigen Minuten alles wieder da. Welch ein Glück. Ich bin sicher, dass meine philosophische Grundausbildung die erste Panik verhindert hat.
Читать дальше