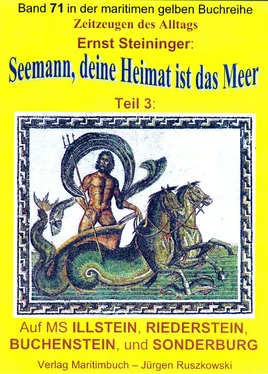Ein anderes Erlebnis: Allerdings kann ich weder von dem eben geschilderten noch von dem zu schildernden mit Sicherheit behaupten, ob es sich im costaricanischen Puntarenas oder im nicaraguanischen Corinto abgespielt hat. Eigentlich ist es ja e wurscht. Nun ist es aber so, dass die doch sehr unterschiedliche Qualität der zugrunde liegenden Ereignisse Rückschlüsse auf die Verhältnisse der angesprochenen Städte zulässt, und das ist dann vielleicht doch wieder nicht ganz so wurscht. Ich denke, der Film, den ich gerade in meinem Kopf ankurble, scheint sich eher in Corinto abzuspielen.
Vor meinem inneren Auge entsteht eine düstere, nur spärlich mit künstlichem Licht ausgeleuchtete, gespenstisch anmutende Welt. Im Vordergrund, bis an die Hafenmole reichend, breitet sich ein Rangierbahnhof aus, auf dem zusammengekoppelte Güterwaggons in langen Reihen wie kopf- und schwanzlose Blechschlangen herumstehen. Im Hintergrund, vor nur noch schwach erkennbarer Bergsilhouette, unter nur noch schwach fluoreszierenden Federwolken, liegt vermutlich das „Zentrum“. Genau da will ich hin. Ich bin spät dran und solo – und jetzt sehe ich mich auch noch massiv daran gehindert, mein Vorhaben zügig auszuführen: Eine dieser Blechschlangen versperrt mir den Weg. Weil ich mir nicht sicher bin, ob die Schlange nicht etwa doch einen fauchenden, rußenden Kopf hat, wage ich es vorerst nicht, die Blockade einfach zu unterkriechen. Die üppig mit Disteln und Dornen ausgestattete Vegetation links und rechts des Teerstranges, der den Namen Straße nur seiner Konkurrenzlosigkeit verdankt, zwingt mich zum Handeln: Entweder – oder…
Immer wiederkehrende Rangier-Blockaden verleiden mir den Weg ins „Zentrum“, von dem ich eh schon gar nicht mehr glaube, dass es ein solches überhaupt gibt. Inzwischen scheint mir das weitere Vordringen sowieso nicht mehr nötig zu sein. Beidseitig der Zufahrtsstraße, aber auch direkt im Bahngelände, neben den Gleissträngen, stehen vereinzelt oder sich gegenseitig stützend hölzerne oder aus Ziegelresten zusammengeflickte Bruchbuden. Mit bunten Lämpchen und lärmender Musik-Box werben sie um die in dieser trostlosen Einöde umherirrenden Nachtschwärmer. Im Licht einer Straßenlaterne glaube ich ein mir wohlbekanntes Gesicht zu sehen. Ja doch, es ist der Moses! Spuckend, rotzend, wie ein Rohrspatz schimpfend kommt er auf mich zu. Er ist so mit sich beschäftigt, dass er mich kaum wahrnimmt. Ich stelle ihn zur Rede und frage teilnahmsvoll: „Na, Moses, was ist los mit dir? Hast du etwa was Falsches in den Hals gekriegt?“ Der Bursche, vielleicht gerade sechzehn Jahre alt, sieht mich anstelle einer Antwort trotzig, ja fast zornig an. Dann bricht es aus ihm heraus: „Pfui Teufel, so eine Scheiße! Diese alten Lügner! So ein verlogener Mist, das nun soll das Tollste sein, das man einer Frau antun kann?“ Dabei rubbelt er intensiv mit dem Zeigefinger über seine Lippen und die zum Spucken vorgestreckte Zunge, so als wolle er sie von irgendwas befreien. Ah, nun kapiere ich: Irgendjemand hatte ihn dazu gebracht, das zu tun, was unter Janmaaten „In den Keller steigen“ genannt wird. Und weil das „In den Keller steigen“ oft genug in geselliger Saufrunde als das „Non plus Ultra“ sexuellen Abenteuers geschildert wurde, musste man es auch mindestens einmal gemacht haben, um mitreden zu können …
Ich versuche ihn zu besänftigen: „So was bringt einen Seemann doch nicht um!“ Und wenn ihm schon einige Härchen im Rachen hängen geblieben sein sollten, dann sollte er nicht wie ein Lama in der Gegend herumspucken, sondern sich lieber schnell noch ein Bier in den Hals kippen. Mitfühlend klopfe ich ihm auf die Schulter und ermuntere ihn, mich in die nächstgelegene Pinte zu begleiten. Aber sein momentaner Widerwille gegen die ganze Matrosen-Zunft, mich eingeschlossen, ist offensichtlich stärker; immer noch zutiefst beleidigt, trollt er sich spuckend von dannen…
Ob ich in dieser Nacht noch bis ins Zentrum der Lustbarkeiten gelangte, das weiß nur mein Schutzengel, und der ist nicht sehr redselig (wahrscheinlich weil er genau weiß, dass es wenig Sinn hat, mir ins Gewissen zu reden). Jedenfalls war ich am Morgen zum Arbeitsbeginn wieder an Bord, wenn auch in leicht lädiertem Zustand. Hans Ballermann aber fehlte – als einziger. Er fehlte auch noch, als wir am späten Nachmittag damit begannen, das Schiff wieder seeklar zu machen. Ich machte mir Sorgen um ihn. Der Hafen lag im Herrschaftsbereich des berüchtigten Somoza-Regimes. Es hieß, dessen „Fänger“ gingen mit achteraus gesegelten, mittellosen Seeleuten nicht besonders fürsorglich um. Also ging ich zum Ersten und machte mich erbötig, noch eben mal nach Hans Ballermann sehen zu dürfen. Schwertfisch sah mich an, als ob er mich gleich im Ganzen verschlingen wollte: „Sie, Sie ganz bestimmt nicht!“ zischte er – und beorderte die doofe „Oase“, den allgemein als Arschkriecher betitelten Offiziersanwärter, mit der Suche nach Hans. Hans zu finden, war dann auch nicht allzu schwer, angeblich lag er vor der erstbesten Kneipe im Staub. Und danach sah er auch aus, als er völlig abgerissen im Schlepptau des OA die Gangway herauf torkelte. Ein Bild des Jammers! Ich schämte mich für ihn, schämte mich meiner Freundschaft zu ihm und wandte mich feige ab. Später dann, auf See, nahm sich Schwertfisch in seiner bewährten Art den inzwischen ausgenüchterten Ballermann zur Brust. Darauf angesprochen, erklärte uns Hans, dass er die Abreibung ja verdient habe und dass ihm so eine unbürokratische Abmahnung lieber sei als Tagebucheintragungen und Geldstrafen. Außerdem vertraute er mir noch an, dass es nicht die Faustschläge des Ersten waren, die sein Ego verletzten, sondern, dass er ausgerechnet von der dämlichen Oase aufgespürt und abgeführt wurde…
Nikaragua: Der Name dieses „Bananenstaates“ geht wohl auf den toltekischen Kaziken Nicarao zurück. Dieser Kazike, so erfahre ich durch Wikipedia, versuchte vorerst mit dem europäischen Räuberpack, das Columbus nachfolgte, im Guten auszukommen. Der Goldgier und der christlich verbrämten Menschenverachtung der königlich-spanischen Mord-AG hielt aber auch diese Strategie nicht lange stand. Die indigenen Völker Nicaraguas wurden alsbald versklavt und als Arbeitstiere in die Silberminen Perus verschleppt. Der Mönch Bartolomé de las Casas, sozusagen das unfreiwillige historische Gewissen der Konquistadoren, schrieb 1552: „Im gesamten Nicaragua dürften heute 4.000 bis 5.000 Einwohner leben, früher war es eine der am dichtesten bevölkerten Provinzen der (spanischen?) Welt“.
Das Wappen Nicaraguas zieren fünf wie Reihenhäuser aneinander gefügte Vulkane. Über diesen gleichförmigen Zuckerhüten schwebt, gleichsam wie der „Heilige Geist“, eine rote Jakobinermütze. Ob diese Mütze, die der französischen „Briefmarken-Marianne“ so hübsch steht, stilisierter Ausdruck einer permanenten Revolution sein soll? Eher nicht. Eher war sie das Freiheits-Symbol des Generalkapitanats Guatemala, zu dem auch Nicaragua gehörte und das sich am 15. September 1821 von Spanien lossagte. Die daraus entstehende Konföderation „Vereinigte Provinzen von Zentralamerika“ hielt nicht lange vor, und seitdem wurschtelt jede dieser ehemaligen Provinzen als Kleinstaat vor sich hin. Innerhalb der einzelnen Staaten kämpften (und kämpfen) dann jeweils die Eliten aus konservativen und liberalen Kreisen um die Macht.
In Nicaragua rissen 1909 – mit tätiger Hilfe der USA – die Konservativen mit einem Putsch die Macht an sich. Der Preis für die nicht ganz uneigennützige Hilfe der Nordamerikaner war der Ausverkauf des Landes. Fortan kontrollierten US-Gesellschaften den Bergbau, die Eisenbahn, die Banken und das Zollwesen. 1926 nahm der legendäre Freiheitskämpfer Sandino mit vorerst nur dreißig Mann den Kampf gegen die US-Besatzungsmacht auf. Mit Erfolg: Sandinos stetig anwachsende Guerilla setzten den Yankies so zu, dass sie 1933 entnervt das Land verließen. Daraufhin legten die Sandinos ihre Waffen nieder – ein folgenschwerer Fehler! Denn das war die Stunde Anastasio Somozas, der natürlich gar nicht daran dachte, seine von den Amerikanern bezahlte und geschulte Nationalgarde vertragsgemäß ebenfalls zu entwaffnen. 1934, nach der programmgemäßen Ermordung Sandinos, war der Weg frei für die vierzig Jahre währende Diktatur des Somoza-Clans. Aber so wie sich die Somoza-Diktatur wie Mehltau über das Land ausbreitete, so gärte Sandinos Vermächtnis, wie der Geist in der Flasche, im mundtot gemachten Volk. Aber ich will nicht vorgreifen… So viel noch, ich zitiere: Am 17. Juli 1979 verließ Somoza unter Mitnahme der Staatskasse und der Särge seines Vaters und Bruders das Land und setzte sich nach Miami ab. Nicaragua war befreit. Der Befreiungskampf hatte mehr als 50.000 Nicagaruaner das Leben gekostet und hinterließ ein weitgehend zerstörtes Land.
Читать дальше