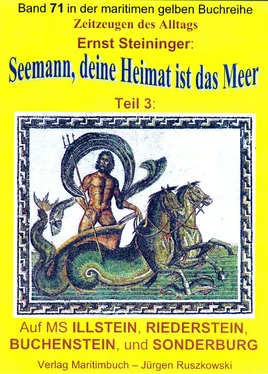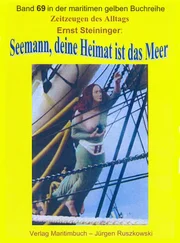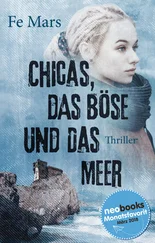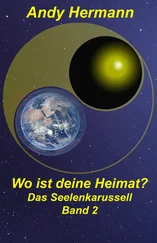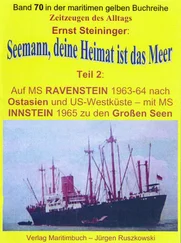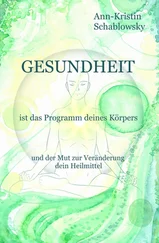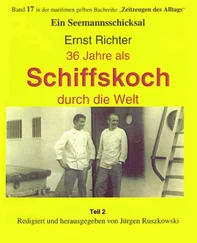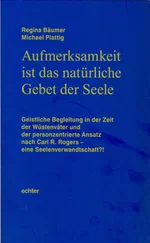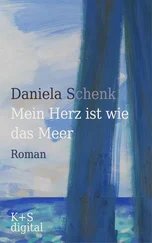Vielleicht sollte ich noch kurz erklären, warum das möglichst schnelle Einholen der achteren Schleppleine von so großer Wichtigkeit ist. Ohne Umdrehungen der Schraube ist das Schiff praktisch manövrierunfähig. Erst der durch die Umdrehungen erzeugte Druck auf das Ruderblatt macht dieses als Steuerelement wirksam. Aber solange sich besagte Stahltrosse in diesem sensiblen Bereich befindet, ist an eine Benutzung des Eigenantriebs nicht zu denken. Zu groß ist die Gefahr, Ruder wie Schraube, die Achillesferse eines Schiffes, zu beschädigen. Von daher ist die Nervosität so mancher Kapitäne während dieser bangen Momente schon verständlich, weil im stark frequentierten Fahrwasser, im versetzenden Strom und womöglich noch bei schlechter Sicht das Schiff quasi gelähmt ist. Weniger verständlich aber bleibt die sinnlose Antreiberei. Aber unser kleiner Kapitän, dessen unüberhörbares „Sächseln“ hinter seinem Rücken immer wieder zur allgemeinen Heiterkeit beiträgt, hat halt nicht mehr die besten Nerven.
Der Bootsmann entlässt uns natürlich noch nicht – wie richtig ich ihn doch eingeschätzt habe! Erst wenn die Leinen „weggeschossen“ sind, dürften wir die Station verlassen. Purer Unsinn! Die Leinen seefest zu verstauen, hätte bei der langen Revierfahrt die Elbe hinunter auch noch bis morgen Zeit. Aber unser Bäuerlein will halt wieder einmal glänzen. „Gut so“, sagt der Zweite und verzieht sich auf die Brücke, um dem Alten sein Sprüchlein aufzusagen: „Achtern alles klar, Herr Kapitän. Der Bootsmann schießt noch eben die Leinen auf.“ Noch eben! Noch eben mal dies, noch eben mal das – dieser biedere Ausdruck noch biederer Bootsmänner hat selbst schon die friedfertigsten Janmaaten zur Weißglut gebracht. Bedeutet er im Klartext doch nichts anderes, als dass eine aufschiebbare Arbeit unnötiger Weise sofort zu erledigen ist, während eine unumgängliche Schwerarbeit gern zur Nebensache verniedlicht wird.
Inzwischen ist es halb vier geworden. Dem Urteilsvermögen des Ersten, na, wahrscheinlich eher dessen Laune, habe ich es zu verdanken, dass ich wieder einmal mehr Vier-Acht-Wächter bin. Während sich meine Kollegen in ihr Logis verdrücken, um bis zum Arbeitsbeginn noch schnell eine Mütze voll Schlaf zu nehmen, versuche ich noch schnell meine Unterarme mit einer Handvoll Twist von der eklig klebenden, übel riechenden Labsalbe zu befreien. Die Labsalbe, was für ein hübsches Wort, ist ein im „Eigenbau“ vom Bootsmann oder von dessen rechter Hand, dem Kabelgatts-Ede, nach uralten Segelschiffs-Rezepten hergestelltes Drahtseil-Konservierungsmittel. Und je nach Dummheit oder Gehässigkeit dieser „Experten“ ist halt dann die Schmiere auch mit mehr oder weniger Tran und Braunteer vermischt.
Wir passieren Toller Ort. Der Vorderschlepper wird entlassen, der Hafenlotse geht von Bord, die Maschine beginnt zu wummern, das Schiff nimmt Fahrt auf. Während ich mich über die Außentreppen auf den Weg nach oben mache, schweift mein Blick noch einmal kurz zurück. Ein Blick zurück, im Zorn? St. Pauli, der Michel, die Landungsbrücken: Im diffusen Lichte der Stadtbeleuchtung, der aufdringlichen Reklamelichter, erscheint mir auf einmal alles irgendwie abgestanden, säuerlich… Hamburg: Tor zur Welt, Stadt der mächtigen Reeder, Stadt der Wirtschafts- und sonstiger Kapitäne, Stadt der Nutten und Lottls, Verteilungslager bajuwarischer, österreichischer, spanischer, türkischer Seefahrer. Hamburg, du alte … – ach scheiß drauf, Scheiß Hamburg…
Leidlich gesäubert melde ich mich auf der Brücke, um sogleich den Rudergänger abzulösen. Mit der üblichen Redewendung „Ich geh dann mal eben nach unten“ – was soviel heißt wie: Ich tauche bis zum Lotsenwechsel in Brunsbüttelkoog erst einmal ab – macht sich der Alte davon. Der an Bord gebliebene Revierlotse ist sichtlich erleichtert, die „Tratschtante“ los zu sein. Er kann sich nun völlig auf seine Arbeit konzentrieren. Sachlich, im ruhigen Ton, gibt er seine Anweisungen an den Rudergänger und an den am Maschinentelegrafen stehenden Offizier. Sie sind schon eine Klasse für sich, diese Revierlotsen. Immerzu mit heiklen Situationen konfrontiert, wirken die meisten von ihnen doch ruhig und gelassen. Ob auf der Elbe, der Weser oder der Schelde, ob auf der Themse, der Seine oder dem Mississippi – ganz egal, auf welchen Revieren auch immer – ihr Beruf verlangt ihnen diese spezifischen Eigenschaften einfach ab: Übersicht, Durchsetzungsvermögen, Entschlossenheit und nicht zuletzt Gelassenheit. Dennoch kann auch der beste Lotse dem Kapitän die Verantwortung nicht abnehmen. Und deshalb wird unser hochgradig nervöser Käpt`n Dietze beim leisesten Furz der Maschine oder nach einer nur etwas zu heftig durchgeführten Kursänderung sofort wieder, wie weiland Rumpelstilzchen, auf der Brücke herumspringen.
Das mache ich jetzt auch. Ich springe zurück in die Gegenwart, um mich aber sogleich wieder von den Erinnerungen an Kapitän Dietze, Hans Ballermann, Rosaria und Paule gefangen nehmen zu lassen. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte: Das Reiseziel war die Westküste Zentralamerikas. Die Überfahrt bis zum Panama-Kanal verlief für die Jahreszeit – Oktober / November – ganz normal. Das heißt, bis weit über die Azoren hinaus hatten wir das übliche nordatlantische Schweinewetter.

nordatlantische Schweinewetter
Ein Foto, das ich von der Nock aus „geschossen“ habe; lässt erahnen, mit welcher Wucht und Gewalt die See auf ein Schiff einschlagen kann. Offensichtlich konnte ich mich im letzten Moment noch in die Brücke hinein retten, weil es sonst zumindest dieses Foto nicht gäbe. Bei längerem Betrachten des Bildes bekomme ich nachträglich noch weiche Knie! Dass das Schiff diesen „Kaventsmann“ überstand, das war wohl mehr Glück als Seemanns-Verstand…
Zu Hans Ballermann (Name geändert), von dessen Anwesenheit ich mir geistige Anregung versprach, hatte ich während der ganzen Reise kaum Kontakt. Gerade, dass wir uns bei der Wachablöse – er war Null-Vier-Wächter – begegneten. Das änderte sich auch dann nicht, als das Wetter besser wurde und das Arbeiten an Deck wieder zuließ. Denn nun ging es ums Geldverdienen, sprich: Überstundenkloppen! Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Herr Schwertfisch, (Name geändert), erster Offizier und ein Mann mit der Statur eines Hufschmiedes, war der damals noch durchaus gängigen Meinung, dass die Masten und Schotten der ILLSTEIN von ihrem dicken Farbanstrich befreit werden sollten. Teure Farbe, oft genug überflüssigerweise, dafür aber Reise für Reise, also wenigstens vierteljährlich, übers ganze Schiff verteilte, fachmännisch verarbeitete Farbe sollte also partiell entfernt – und dann wieder neu aufgetragen werden. Immerhin gelang es auf diese Weise, das stetige Anwachsen der „Farbenringe“ zu unterbrechen. Nach meinem Verständnis schlicht ein Schildbürgerstreich, den ich aber schlecht unserem sächsischen Kapitän anlasten konnte. Diese Art der Ressourcenverschleuderung war in der „Nachkriegs-Blütezeit“ der deutschen Seefahrt allgemein üblich. Beim Lloyd wurzelte es sozusagen im System: Kein Kapitän, kein Erster konnte es sich leisten, mit einem ungepflegten Schiff in das Visier eines Lloyd-Inspektors zu geraten. Schließlich hing von dem sein Weiterkommen ab. Aber selbst wenn sie sich das nur eingebildet haben sollten, es lag nun einmal in der Natur der Sache, dass der eine Kapitänsanwärter dem anderen vorgezogen werden wollte. Und so waren unisono alle ersten Offiziere bemüht, dass ihr jeweiliges Schiff bei der Ankunft in Bremen wie ein frisch gewienertes Osterei glänzte.
Schwertfisch war nicht mehr der Jüngste. Möglicherweise war er bei der einen oder anderen Beförderungswelle schon mal übersehen worden. Wie dem auch sei und was auch immer der wahre Grund dafür sein mochte: Er ließ „Farbe kloppen“. Das bedeutete, dass fast die gesamte Deckscrew, mit handlichen Kugelhämmern ausgestattet, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends auf die ausgesuchten Objekte losgelassen wurde. Das waren in der Regel zumeist der Schornstein, die Masten, Lüfter etc. Um die Farbe abplatzen zu lassen, bedurfte es schon ziemlich kräftiger Schläge, die mitunter etwas zu kräftig ausfielen – z. B. auf die nicht ganz so dickwandigen Schutzbleche der Lüfterköpfe. Das wiederum war nicht in des Schwertfisches Sinne und zog für denjenigen, der so seine Unwilligkeit am wehrlosen Metall demonstrierte, eine kurze Aussprache mit dem Ersten nach sich. Die fand dann an einer nicht einsehbaren Stelle des Kapitänsdecks statt. Obwohl sich die Delinquenten nur sehr vage über die Art der Aussprache ausließen, wurde es doch ruchbar: Der Mann wurde handgreiflich. Eigenartigerweise schadete das dem Ansehen des an sich wortkargen Mannes nicht, im Gegenteil! Auch Hans Ballermann, der wiederholt zu einer dieser wortkargen Aussprachen zitiert wurde – allerdings nicht wegen mutwilliger Sachbeschädigung – beschwerte sich hinterher nicht nur nicht, sonder meinte nur lapidar, dass diese Art der Aussprache allemal besser sei als eine Tagebucheintragung…
Читать дальше