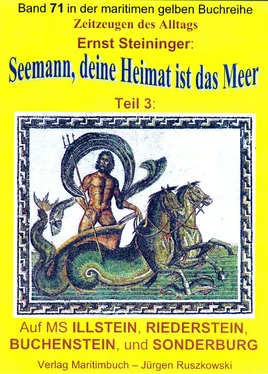Instinktiv versuchte ich zu kneifen. Das war mir nun doch eine Nummer zu surreal. Ich sah mich in einen Film zurück versetzt, in dem sich biedere Bürger nach Einbruch der Dunkelheit in Ratten verwandelten, allerdings, ohne dabei ihre menschliche Gestalt einzubüßen. Und, im Gegenteil zu Ballermanns Kellerratten, waren es sehr elegant gekleidete Männlein und Weiblein. Das Anstößige daran war, dass den blütenweißen Stehkragen der schwarzbefrackten Herren menschlich aussehende Rattenköpfe aufgesetzt waren. Ebensolche, jedoch weitaus putzigere Köpfchen, zierten die mit glitzernden, gleißenden Colliers behängten, aber sonst nackten Hälse der Damen. Überhaupt zeigten die Damen – außer anschmiegsamen Fuchs- und Marderpelzen – sehr viel glatte Haut. Auch kamen sie mit dem obligaten Rattenschwanz, den sie vorwiegend wie eine Stola um die blanke Schulter trugen, viel besser zurecht als ihre männlichen Partner…
Ratte, ratte, rette sich wer kann – mein lieber Mann, das ist leichter gesagt als getan! Eine, nein, keine Ratte – eine mausgraue Alte, schwere, trübe Hornbrille auf der ausgetrockneten, verknautschten Nase, hält mir kommentarlos die Bild-Zeitung unter meine lange, feuchte Nase: „Vorlesen!“ Ich lese vor, lese und trinke und versinke, versinke unaufhaltsam in Hans Buhmanns Welt…
Zu Hansens Ehre sei gesagt, er war kein Bettler. Vollmatrose, der er war, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Gelegenheitsarbeiter im Hafen oder wenn es sich ergab, eben als Urlaubsvertreter auf Hapag- und Lloydschiffen. Er kannte sich und seine Unzuverlässigkeit und mied daher „feste Anstellungen“. Die Vorstellung, eine längere „Durststrecke“, also eine mehrmonatige Seereise auf sich zu nehmen, entsprach nicht seiner Lebensphilosophie. Trotzdem ergab es sich, dass wir zusammen – für „fest“ – auf der ILLSTEIN anheuerten.
Ende Oktober 1965, Auslaufen Hamburg. An dieser Stelle würde ich gern meine ureigensten Originalberichte, die ich gelegentlich so zwischendurch verfasste, mit einfließen lassen. Soll ich? All right – ich wage es…
Zwei Uhr morgens, Auslaufen Hamburg. Die Janmaaten stehen schon klar bei „Leinen los!“ Der letzte Schauermann jumpt noch eben über die Verschanzung. Die Gangway haben wir dem etwas zu säumigen Agentenlehrling bereits unter den Füßen weggezogen. Die Schlepptrossen straffen sich; ab geht die Post. Wer über die Abschiedsgepflogenheiten in der ordinären Frachtschifffahrt im Unklaren sein sollte, dem sei kurz gesagt: Es gibt keine. Kein Ehrensalut, keine Deutschmeisterkapelle oder vielleicht gar einen Shanty-Chor, auch keine Kusshändchen hauchenden Dockschwalben. Selbst die höchst anständigen Ehegattinnen, die des Kapitäns, der Offiziere und Ingenieure, des Funkers und des Chefstewards, haben ihre Männer schon vor Stunden verlassen. Wer lässt sich schon gerne um zwei Uhr morgens an die kühle Nachtluft setzen.
Langsam zieht der Vorderschlepper das Schiff durch den Kaiser-Wilhelm-Hafen. Vorbei an der langen Reihe der Lagerschuppen: Schuppen Nr. 74, Nr. 73, Nr. 72, Nr. 71; hier liegen sie, die Lloyd- und HAPAG-Liner, Bug an Heck, aufgereiht wie die Perlen an einer Gebetsschnur. Mich fröstelt es, meine Laune ist am Tiefpunkt. Die Vorstellung, dass allmächtige Konzernherren die Schiffe samt Fracht und Menschen wie die Perlen einer Gebetsschnur durch ihre gepflegten Hände gleiten lassen, macht mich auch nicht fröhlicher. Im grellen Licht zahlloser Hochkerzen rotieren auf engstem Radius unentwegt schlanke Kräne neuester Bauart. Sie erinnern mich an Geier, deren Schnäbel Hiev um Hiev in den geöffneten Bäuchen der Frachter verschwinden, um ihnen entweder ihre fremdartigen Schätze zu entreißen oder sie mit profanen Kisten, sperrigen Konstruktionen oder Fahrzeugen vollzustopfen.
An Backbord gleißt, zu einem sprühenden Lichtbündel verschmolzen, die bläuliche Flammenglut vieler Schweißaggregate. Pausenloses Gedröhne, Geratter, Gezische: Die Werft – für jeden rechtschaffenen Seemann ein Ort der Verwünschung. Wehe dem Schiff, das notgedrungen in die Hände der Werftarbeiter fällt. Da bleibt kein Auge trocken. Alles, was dem Seemann heilig ist, ist diesen Barbaren völlig wurscht. Überall dort, und nicht nur dort, wo sie zu tun haben, hinterlassen sie „verbrannte Erde“. Die Motormänner stehen tränenden Auges vor ihren einstmals blitzblanken Handrädern und Ventilen, die Reiniger sehen fassungslos auf ihre verölten, verdreckten Flurplatten… Wir Decksbauern schaufeln uns durch Unmengen von Schlacke, abgeblätterten Rost, verkohlte Farbe, durch Berge von Elektroden- und Verpackungsresten… Das Küchenpersonal vermisst den Schlüssel für die Provianträume, dem Steward sind Teller und Tassen abhanden gekommen, und dem Messeboy fehlen Kehrblech, Handfeger und die letzten Rollen Toilettenpapier. Dreck, Lärm, Rauch und Gestank dringen durch alle Ritzen. Eine Werftzeit kann man eigentlich nur im Suff aussitzen. Und wenn die Werft, wie in diesem Fall, Howaldt heißt, dann ist man im „Levermann“, der nächstgelegenen Kneipe, bestens aufgehoben.
Wir, die Achtergang, stehen noch immer wegen des Einholens der Schlepptrosse klar. Im Moment ist sie gespannt wie eine Gitarrenseite, der Schlepper zieht das Heck, natürlich samt Schiff, um das an Steuerbord liegende Kaiser-Wilhelm-Höft herum. „Achterschlepper los!“ schallt es plötzlich aus dem Lautsprecher der Wechselsprechanlage. Im selben Augenblick klatscht auch schon die vom Schlepperkapitän per Slip-Haken gelöste Leine ins Wasser. Mit geübten Griffen werfen wir sofort das in Achterschlingen um einen Doppelpoller liegende schwere Drahtseil los, nachdem wir es mit ein paar Törns ums Spill vor dem Ausrauschen gesichert haben.
Kaum ist die Schleppleine im Wasser, will der Alte – von Statur ein kleiner Mann, dafür aber ein ganz großes Nervenbündel – auch schon wissen: „Ist die Schraube klar?“ – „Nein, Schraube ist noch nicht klar!“ antwortet der Zweite dem Lautsprecher. „Ist die Schraube klar?“ – „Nein, Schraube ist noch nicht klar!“ brüllt der Zweite gereizt in den Lautsprecher hinein. Aber aus diesem schallt es unentwegt, zuerst forsch fordernd, dann zunehmend anklagend und schließlich geradezu winselnd zurück: „Schraube klar, Schraube klar, ist die Schraube klar…“
Inzwischen ziehen wir – in „Gänsemarschaufstellung“, Hand über Hand – das nasse, dreckverschmierte, frisch gelabsalbte Stahlseilende mit Muskelkraft durch den Hafengrund an Deck. So eine Schlepperleine kann ganz schön lang und ganz schön schwer sein; dementsprechend kann es schon einige Minuten länger dauern, bis endlich das Auge unterm Schiffsarsch sichtbar wird.
„Ist die Schraube klar, Schraube klar?“ Das unentwegte Gequake und Gewinsel des Alten raubt dem Zweiten seine sonst mit so viel Nachdruck zur Schau gestellte Gelassenheit. Seiner tadellosen Uniform und seiner feinen Lederhandschuhe nicht achtend, reißt er wie ein wild gewordener Matrose nun ebenfalls an der nicht endenden wollenden Stahltrosse. Zwar könnten wir zum Einholen der Leine auch das eigens dafür gedachte Spill verwenden. Aber unser Bootsmann, ein von der Hunte stammender, schollenflüchtiger Kleinbauer, hat wohl eine angeborene Aversion gegen technische Geräte. Also nutzt er jede Gelegenheit, dem „nümodschen Kram“ eins auszuwischen. Und weil ihm die Übersetzung des Verholspills zu langsam ist, heißt es dann: Nix wie ran, und mit „man tau“ und „noch een“ wird wieder einmal mehr „aleman winscha“ geübt…
Endlich klatscht das mit Mudd behängte Auge an Deck. Der Zweite macht einen Satz in Richtung Lautsprecher, schreit lauthals die befreiende Meldung: „Schleppleine ein, Schraube klar!“ in den Trichter. Aus dem ist noch kurz ein letztes Schniefen des Alten und dann die Stimme des Ersten zu vernehmen: „Genug achtern!“ Damit wären wir eigentlich entlassen, aber wie ich unseren Bootsmann einschätze…
Читать дальше