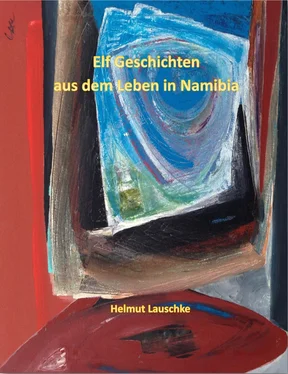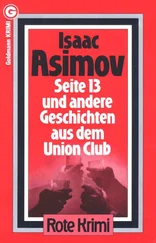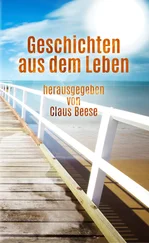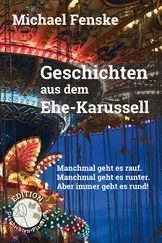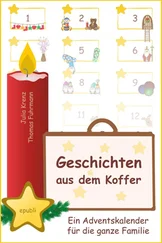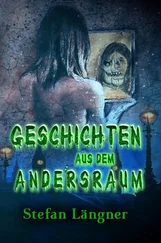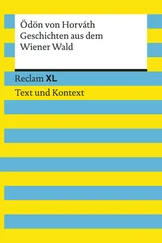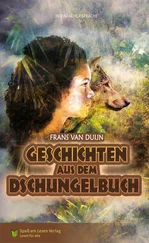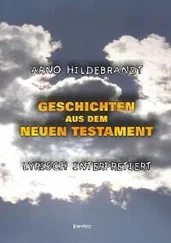Dr. Ferdinand schaute nach den Patienten auf der 'Intensiv'-Station, trug die klinischen Daten in die Krankenblätter ein, wünschte den Schwestern, die gerade die Verantwortung für die Patienten der Nachtschicht übergaben, eine ruhige Nacht und machte sich auf den Weg zur Wohnstelle. Der Himmel hatte sich blutrot verfärbt, und der glühende Sonnenball senkte sich dem Horizont entgegen. Es war eine Art Nostalgie, dass er sich beim auf dem Vorplatz, dem der Uringeruch nicht wegzunehmen war, noch einmal zur Rezeption umdrehte. Doch mit der Unabhängigkeit war auch die nächtliche Sperrstunde verschwunden. Nun richteten sich hier die Menschen nicht mehr mit Decken, Pappen und Zeitungspapier ihr Lager für die Nacht ein, saßen nicht mehr nebeneinander, klapperten und löffelten nicht mehr in Blechdosen herum, pafften nicht mehr in den Pfeifenstummeln ihr scharfes Kraut. Die Zeit der nächtlichen Koevoetkontrollen mit den Verhören, Schlägen und Deportationen gehörte der Vergangenheit an wie die Ängste, von Granaten getroffen zu werden. Da war das Leben zu einer Norm der Ruhe und Sicherheit zurückgekehrt. Dennoch gab es kaum strahlende Gesichter. Die Armut drückte auf die Familien. Viele lebten in tiefer Not. Hinzu kam das Wegsterben der jungen Menschen durch AIDS. Da waren es mehr die Frauen als die Männer, und sie ließen ihre Kinder als Waisen zurück. So kamen auf die Alten mit der kleinen Rente die Waisenkinder noch dazu, die von ihnen verpflegt und aufgezogen wurden, wenn es die Tante nicht gab, die sich um die Verwaisten kümmerte, weil auch sie von diesem Virus getroffen war und entkräftet in den letzten Zügen lag. Dr. Ferdinand nahm den Weg an den fünf Caravan-Häusern vorbei, die nun von einheimischen Menschen bewohnt waren. Der Zustand der Häuser war heruntergekommen. Sie sahen schmuddelig und ungepflegt aus. Nur am ersten Blockhaus, in dem Sarah mit der Beinprothese und ihrem Kind wohnte, waren die Fenster geputzt und die Treppenstiegen sauber. An den andern Häusern waren die Fensterscheiben verschmiert und einige zerbrochen. Es gab Stiegen, die mit Eimern, Töpfen und anderem Zeug vollgestellt waren. Andere hatten angebrochene und eingeknickte Stufen. Er ging am zerfledderten Lattenzaun entlang, der auf der anderen Seite des Weges war, über den Platz vor der Stadtverwaltung mit den noch verbliebenen alten Bäumen, am botanischen Kasten mit den beschrifteten Blättern vorbei, betrat die Teerstraße und bog die zweite, die Sandstraße vor dem Funkgebäude rechts ab. Die Sonne hatte sich zu einem glutroten Ball verdichtet, der sich dem Horizont entgegenneigte. Dr. Ferdinand trat durch die Einfahrt, schloss das Tor hinter sich, überquerte den kleinen Vorplatz, öffnete die Eingangstür und eilte zum Telefon, das zu klingeln aufhörte, als er nach dem Hörer griff. Er streifte die Sandalen mit den schwitznassen Korksohlen von den Füßen und das durchschwitzte Hemd vom Körper, das er über die Rückenlehne eines Stuhles warf. Er zündete sich eine Zigarette an, setzte sich auf den Terrassenabsatz und sah dem untergehenden Feuerball nach, der mit dem Versinken am Horizont die Glutbänder vom Abendhimmel nachzog, dass mit der ersten Dämmerung der Abendstern dicht über der auffahrenden Mondsichel stand, als stünde der Steuermann schon in der Gondel. Bei der Abendbetrachtung fuhren ihm die Zeilen durch den Sinn:
An mir hängend mit dem Geist, o Prthã-Sohn,
Meditation übend, auf mich gestützt
wie du mich zweifelsfrei
vollständig erkennen wirst, das höre!
Dieses Wissen mitsamt dem Erkennen
werde ich dir verkünden ohne Rest.
Wenn du das erkannt hast, bleibt dir hier
nichts anderes mehr zu erkennen übrig.
Unter Tausenden von Menschen strebt
kaum einer nach Vollendung.
Von den erfolgreich Strebenden
kennt kaum einer mich in Wahrheit.
Erde, Wasser, Feuer, Wind
Luftraum, Geist wie auch Verstand
und Ichbewusstsein:
dies ist meine achtfach aufgeteilte Natur.
(Bhagavadgïtã, 7. Gesang)
Das waren Worte des Erhabenen (bhagavat) in seinem Gesang (gïtã) an den Helden Arjuna, dem Protagonisten der Pãndavas, der Verwandten, Freunde und Lehrer, die ihm im Kreig gegenüberverstanden. Arjuna fand es selbst für den Fall eines Sieges widersinnig, gegen seine Verwandten Krieg zu führen. Er fühlte sich unfähig und nicht gewillt, seine Verwandten zu töten. So entspann sich ein Gespräch mit dem Wagenlenker, der kein anderer war als Krsna, die Inkarnation des Gottes Visnu. Bhagavat vermittelt in der Gïtã dem Helden Arjuna (einer der fünf Söhne des Pãndu) die Grundsätze des pflichtgemässen Handelns. Das Kernstück seiner Belehrung ist die Ethik, in der drei Forderungen des Visnu-Krsna zu erfüllen sind:
1. Karman, die Tat, wobei die Tat selbstlos sein soll.
2. Streben nach Wissen und Erkenntnis (Jnãna). Wissen ist das beste Mittel der Läuterung. Wissen ist die Voraussetzung zur Meditation und Vereinigung mit der Gottheit.
3.Meditation und Abkehr von weltlichem Verlangen; die Hingabe zu Gott (Bhakti), die Verkündung der Gottesliebe. Wer Krsna ehrt und liebt, findet den Frieden im Herzen und gelangt einst zu ihm.
Ferdinand sprach die Zeilen langsam und lispelnd vor sich hin und hörte den Worten nach, wie sie in die Dämmerung hinaus flogen, die irdische Schwere abstreiften und sich weit weg in Silben und schließlich in Buchstaben auflösten. Sie formten Wolken, aus denen der große Regen kam, der die Menschen vor der Trockenheit und dem Hungertod bewahrte. Die gelispelten Metamorphosen liefen in der Stille ab. Der ersehnte Frieden war weit. Er war für die Worte nicht, vielleicht für einige Silben und ihre Bruchstücke noch unerreichbar. Doch die Laute, die da mehr gedacht als gesprochen wurden, waren voll im Klang mit nur kleinen Dissonanzen. Dr. Ferdinand ordnete den schwingenden Worten mit den ausschwingenden Silben und den weiterschwingenden Gedanken die Klänge Beethovens aus dem Andante der Mondscheinsonate zu und summte die Zeilen mit dem wörtlich Gedachten gebetsmühlenhaft bis ans Ende der Musik. Er betrachtete den Abendhimmel mit den aufkommenden Sternen und versuchte, die Tagesschwere abzustreifen und sich im Kosmos ganz zu integrieren. Es war sein Wunsch, in die Nacht fortgetragen zu werden, um den Frieden zu finden, den er zum Leben. Denn das Leben war gefährdet durch die Probleme, die sich im Alltag stauten und türmten, weil sie unlösbar waren aufgrund menschlicher Versagen mit den ständigen Versprechungen, die nie eingehalten wurden. Beim Wunsch des Fortgetragenwerdens erinnerte sich Dr. Ferdinand an Gandhi's Worte, die er irgendwo gelesen hatte, als der große, weise Mann die Bhagavadgïtã "the universal mother" nannte, "whose door is wide OPen to anyone who knocks". Er zündete sich eine Zigarette an und sah nach oben in die auffahrende Mondsichel, die nun leer und führerlos, ferngesteuert durchs Sternenmeer gondelte und bereit war, neue Passagiere aufzunehmen.
Ferdinand verlor sich in den Weiten. Ihm ging das Höhlengleichnis durch den Kopf, dessen Ausmaße kosmische Dimensionen bekamen. Plato hat das Gleichnis (Staat, 7. Buch) so geschildert:
1. Menschen leben in einer Höhle unter der Erde. Sie sind an Hälsen und Beinen gefesselt und sitzen an immer derselben Stelle. Sie blicken vor sich hin, da sie die Köpfe nicht zurückwenden können. Hinter ihnen führt ein langer Gang nach oben. Von dort dringt das Licht eines Feuers in die Höhle. Zwischen dem Feuer und den Gefesselten verläuft oben ein Weg entlang einer niedrigen Mauer, wo freie Menschen Gerätschaften und Bildsäulen vorbeitragen, die über die Mauer hinausragen. Die Gefesselten in der Höhle sehen von den vorbeigetragenen Gegenstände nur die sich bewegenden Schatten, die durch das Licht des Feuers an die ihnen gegenüberliegende Wand geworfen werden. Für die Gefesselten sind die Schatten die sichtbare Wahrheit, und sie ordnen die gehörten Worte den vorübergehenden Schatten zu. Für die in der Höhle sind die sich bewegenden Schatten an der Wand, die miteinander reden, die volle Wahrheit.
Читать дальше